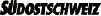
Ägypten hat ein antikes Grab, einen Sarkophag und weitere Begräbnisartefakte in der Thebanischen Nekropole Al-Asasif in der Tempelstadt Luxor enthüllt. Bei dem Fund handelt es sich um die letzte Ruhestätte eines Chef-Mumifizierers.
Er hat zehn turbulente Jahre hinter sich: Repower-CEO Kurt Bobst. Beim «Zmorga» blickt er zurück, verrät, wie er Strom spart, ob er ein Elektroauto fährt und ob er sich in Krisenzeiten auch schon selber infrage gestellt hat.
Zwei neue Wagen sollen beim Glacier Express eine neue Ära einläuten. Gebaut wurden sie in den RhB-Werkstätten der Rhätischen Bahn in Landquart.
Genau heute vor 40 Jahren ist in Graubünden Pionierarbeit geleistet worden: Mit den ersten Schneekanonen haben die Savogniner Bergbahnen den ersten Kunstschnee der Alpen produziert. Trotz den modernen Anlagen von heute gibt es auf dem Gebiet noch viel Potenzial.
Zehntausende Dieselfahrer in Deutschland können sich ab nächster Woche der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen anschliessen. Dann wird das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eröffnet.
Bis zu 70 Handwerker arbeiten im Davoser Eisstadion an der Fertigstellung der ersten Sanierungsetappe. Der Zeitdruck ist enorm, bis zur Eröffnung der Baustelle «Nordseite» bleibt nur noch eine Woche Zeit.
Airbnb bekommt in Israel juristischen Ärger, weil der Online-Wohnungsvermittler Angebote aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland von seiner Webseite genommen hat.
Der Mobilfunkanbieter Salt hat im dritten Quartal des laufenden Jahres einen geringeren Umsatz und Betriebsgewinn verbucht. Die Zahl der Abonnenten konnte indes gesteigert werden.
Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte hat einen neuen Fünfjahresvertrag bekommen. Der im September 2019 auslaufende Vertrag sei bis 2024 verlängert worden, teilte der Versicherer am Freitag in München mit.
Probleme der Autoindustrie und gesunkene Exporte haben den deutschen Aufschwung im Sommer ausgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent.
VW-Generalimporteurin Amag schliesst rund drei Jahre nach Bekanntwerden des Abgas-Skandals ein wichtiges Kapitel ab: Sie hat den Rückruf der betroffenen Autos vollzogen. 100 Prozent der aktuell in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge mit EA 189-Motor sind umgerüstet.
Steuererhöhung, Privatisierung, Liberalisierung der Märkte - mit diesen Massnahmen kämpft Griechenland seit zehn Jahren gegen die Pleite. Auferlegt wurden sie von den Gläubigern des Landes, das seit 2008 finanziell kaum mehr auf die Beine kommt.
In den USA ist der «Black Friday» seit langem der wichtigste Shopping-Event des Jahres. Inzwischen ist diese Tradition auch auf die Schweiz übergeschwappt. Doch manche Experten bezweifeln Sinn und Zweck dieser Rabattschlacht.
Der weltweite Weinkonsum ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen - um 0,8 Prozent auf 244 Millionen Hektoliter. Diese Zahl nannte jetzt das Deutsche Weininstitut in Bodenheim bei Mainz.
Seit Jahren kämpfen die Safranbauern im nördlichen Indien gegen sinkende Erträge. Schuld sind Pilzerkrankungen. Bakterien könnten helfen, die wertvolle Gewürzpflanze zu schützen.
Die Helibauerin in Mollis meldet einen wichtigen Testflug – einen Tag vor der Gemeindeversammlung, die Boden für sie umzonen und abgeben soll.
Ruedi Haller heisst der neue Direktor des Schweizerischen Nationalparks. Der 52-jährige Geograf hat klare Vorstellungen, in welche Richtung sich der Nationalpark entwickeln sollte.
Im dicht bevölkerten Ameisenhaufen könnten sich Krankheitserreger schnell verbreiten. Taucht ein Erreger auf, ändern die Tiere jedoch ihr Verhalten und schützen so die Königin und ihren Nachwuchs, berichten Forschende der Uni Lausanne mit Kollegen aus Österreich.
Der Black Friday hat sich auch in unseren Breitengraden etabliert. Wir haben auf den Churer Strassen nachgefragt, wer den Black Friday kennt und ob der Black Friday als Einkaufstag genutzt wird.
«Artificial Intelligence», also künstliche Intelligenz, kann heute schon beängstigend viel. Auch Musik komponieren, wie eine Infografik zeigt, die auch noch diverse andere spannende Zahlen enthält.
Das Gourmetjournal «Falstaff» hat die beliebteste Bäckerei der Schweiz gesucht und gefunden. Es ist die Bäckerei Signer in Zizers.
Der japanische Autokonzern Nissan entlässt seinen Spitzenmanager Carlos Ghosn. Der in eine Finanzaffäre verstrickte Verwaltungsratschef muss seinen Posten räumen.
Laax und das Telekommunikations-Unternehmen Sunrise haben etwas ausgekocht. Schon diesen Winter wird es im Bündner Skigebiet 5G-Empfang geben - lange bevor es überhaupt Empfangsgeräte für den neuen, deutlich schnelleren Mobilfunk-Standard gibt. Aber gerüstet ist man schon mal und im Winter 2019/2020 dürfte es dann auch Nutzer dafür geben.
Die nächsten Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills sollen in der Ostschweiz stattfinden. Die Ostschweizer Regierungskonferenz unterstützt daher die St. Galler Kandidatur.
Mit dem Erwerb der Betreibergesellschaft Hochgebirgsklinik Davos AG leistet die Kühne Stiftung einen Beitrag zur Stärkung des Medizinstandorts Davos und weitet das Medizinförderprogramm zugleich aus.
Bei der Post-Bankentochter Postfinance bleiben die Ergebnisse auch nach den ersten neun Monate 2018 unter Druck. Weiterhin bröckeln im derzeitigen Negativzins-Umfeld die Zinserträge ab, dazu kommt der Wegfall eines Einmalertrags vom Vorjahr.
Der Appetit der Chinesen auf Edel-Cognac und Kostensenkungen haben bei Remy Cointreau die Kassen klingeln lassen.
Bei Amazon sind durch eine Datenpanne E-Mail-Adressen einiger Kunden für alle sichtbar gewesen.
In der Schweizer Industrie und Bauwirtschaft häufen sich die Anzeichen, dass sich das zuletzt starke Wachstum abschwächen dürfte.
Die Carsharing-Genossenschaft Mobility hat einen neuen Chef gefunden: Roland Lötscher übernimmt den CEO-Posten per Anfang 2019 von Patrick Marti, der im August seinen Abgang angekündigt hatte.

Unter anderem im politisch hart umkämpften Gliedstaat Ohio soll ein Montagewerk von General Motors geschlossen werden. Die Politiker und Gewerkschafter laufen Sturm.
Ein Recherchekonsortium schreckt mit den «Implant Files» derzeit Patienten und die Medtech-Branche auf: Bei Implantaten werde gepfuscht und anschliessend vertuscht, heisst es. In der Schweiz ist das eigentlich nichts Neues, wie drei bekannte Fälle zeigen.
Unternehmen sollen bei medizinischen Implantaten pfuschen und bewusst Komplikationen verschweigen. Ein internationales Recherchekonsortium von Journalisten erhebt schwere Vorwürfe gegen die Branche.
Der grösste Autohersteller Amerikas will Tausende von Arbeitsplätzen streichen. Wegen der Umstellung auf Zukunftstechnologien wie Elektroautos könnten gleich mehrere Werke dicht gemacht werden.
Inzwischen ist Carlos Ghosn auch als Chairman von Mitsubishi Motors abgesetzt worden. Der frühere japanische Staatsanwalt Nobuo Gohara meint, es sei üblich, dass erst nach der Pensionierung einer Person zufliessende Gelder nicht der Tokyo Stock Exchange gemeldet würden.
Die von einer internationalen Journalistengruppe aufgedeckten Missstände bei Implantaten und anderen Medizinprodukten sind auch eine Folge niedriger Hürden bei der Markteinführung. Es gibt zu viele Schlupflöcher für schwarze Schafe.
Wegen einiger schwarzer Schafe und mangelhafter Selbstkontrolle hat sich die Medtech-Branche ihres Erfolgsgeheimnisses beraubt – eine auf Vertrauen und Eigenverantwortung basierende Regulierung, die hilfreiche Produkte und innovative Firmen hervorgebracht hat.
Die neuen Strafmöglichkeiten gegen Technologiekonzerne kaschieren die Unfähigkeit der russischen Behörden. Der Kreml erweist damit der russischen Wirtschaft einen Bärendienst.
Die russische Regierung will die Gesetzesschrauben im Internet weiter anziehen. Grosse Firmen wie Google, Facebook oder Yandex sind besonders gefährdet.
Nach sieben Jahren als oberster Aufseher des globalen Finanzsystems tritt Mark Carney ab. Dem designierten Nachfolger an der Spitze des Financial Stability Board, dem Amerikaner Randal Quarles, schlägt Skepsis entgegen.
Kuka ist einer der technologisch führenden Hersteller von Robotern für die Industrie und war Anfang 2017 nach langem Ringen mehrheitlich vom chinesischen Hausgeräte-Hersteller Midea übernommen worden. Der bisherige Finanzvorstand Peter Mohnen werde interimsweise den Vorsitz des Vorstands ab dem 6. Dezember 2018 übernehmen.
Die Allianz mit Renault sei «nicht ebenbürtig», soll der Vorstandschef bei einem Treffen mit Beschäftigten gesagt haben.
Angefangen hat alles vor zehn Jahren mit einem abstrakten Aufsatz, verfasst unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Heute sorgt die Digitalwährung Bitcoin selbst bei normalen Anlegern für Bluthochdruck. Die wichtigsten Fakten zum Hype und zum Absturz.
Der Entscheid Peter Ulbers, im nächsten Jahr als Verwaltungsratspräsident von Panalpina zurückzutreten, setzt Kräfte frei. Unter neuer Führung kann der Logistikkonzern strategische Optionen von Neuem erörtern.
Am nächsten Freitag wird der Bundesrat über Gegenmassnahmen zum drohenden Entzug der EU-Äquivalenz für die Schweizer Börse entscheiden müssen. Dabei geht es auch um das Rahmenabkommen mit der EU. Bei einer protektionistischen Eskalation steht viel auf dem Spiel.
Die Reiseplattform Booking galt als übermächtig und zog den Zorn der Hoteliers auf sich. Doch auch in der Internetwirtschaft sind Machtverhältnisse nicht zementiert.
Hauskäufe, die zu 100 Prozent über Hypotheken finanziert werden können, erinnern an die Zeit vor der Finanzkrise. Aber lässt sich die Situation wirklich vergleichen?
Dem Basler Medikamentenhersteller Novartis schwebt vor, für neuartige Gentherapien riesige Summen pro Patient zu verlangen. Doch auf derartige Preissprünge sind selbst die Gesundheitssysteme reicher Länder nicht vorbereitet.
Firmen sollen soziale Verantwortung übernehmen. Dieses Credo scheint heute unbestritten. Zum Problem wird die Corporate Social Responsibility allerdings, wenn den Unternehmen Aufgaben zugewiesen werden, die eigentlich der Staat wahrnehmen müsste.
An der SIX wurde am Donnerstag das erste kotierte Krypto-Indexprodukt lanciert. Einer erfolgreichen Entwicklung stehen einige Hürden im Weg.
Kreative landwirtschaftliche Unternehmen wie Regiofair, Jumi oder die Jucker-Farm stossen mit ihren Produkten auf eine rege Nachfrage. Selbst im Ausland können sich Schweizer Produzenten erfolgreich behaupten.
In der informellen Ökonomie Senegals stehen sie ganz unten. Die Wäscherinnen arbeiten inmitten von Verkehr, Lärm und Schmutz, sind rechtlos und verdienen fast nichts. Doch nun beginnen sie sich zu organisieren.
War die mehr als ein Jahr währende Suche nach einem Standort nur Show? Die Wahl von Crystal City als neuem Amazon-Hauptsitz scheint tatsächlich extrem logisch. Und der grösste Gewinner steht bereits fest.
Die slowakische Firma Eset gehört seit kommunistischen Zeiten zu den Pionieren für Antivirenprogramme. Ein Besuch zeigt, wie Cyberkriminelle aufgespürt werden.
Bis im Jahr 2025 will der bolivianische Präsident Evo Morales das ehrgeizigste seiner Projekte fertiggestellt haben. An der Konzeption der transkontinentalen Eisenbahn, die vom Atlantik bis zum Pazifik reichen soll, ist eine Schweizer Firma ganz vorne mit dabei.
Die Kritik an der Marke von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft greift zu kurz. Mediziner sind sich einig, dass die Schadstoffbelastung in der Luft reduziert werden muss – und das geht nur mit einer echten Verringerung des Verkehrs.
Donald Trump hat seine Zweifel an einem durch den Menschen verursachten Klimawandel. Amerikas Behörden sehen das anders. Sie rechnen aufgrund des Klimawandels mit hohen Kosten für die USA.
In Zeiten knapper Erdölreserven schienen Kanadas Ölsande einst eine Wette auf die Zukunft zu sein. Unterdessen hat der Wind gedreht, und für die Konjunktur ist wenig Gutes zu erwarten.
Schleppende Nachfrage auf dem britischen Hypothekenmarkt: Jetzt wollen Baufinanzierer auch mittellosen Erstkäufern den Immobilienerwerb ermöglichen.
Gibraltars Finanzaufsicht nimmt Kryptowährungen den Hauch des Verruchten.
Vom Gewürzhandel über die Unabhängigkeit bis zur Finanzkrise: In der Vergangenheit endete in Indonesien noch jeder Aufschwung im Chaos. Doch diesmal gibt es einen neuen Treiber, den wachsenden Mittelstand.
Die Logistikfirma Ceva will nach den Zusicherungen des Konzernchefs Xavier Urbain ein unabhängiges, an der Schweizer Börse kotiertes Unternehmen bleiben. Zwei von drei Altaktionären haben noch nicht verkauft.
Das irisch-schweizerische Bäckereiunternehmen hat im ersten Quartal mehr Umsatz erzielt, als am Markt erwartet worden war. In Europa hat sich die Lage stabilisiert; in Nordamerika schrumpft das Geschäft dagegen nach wie vor.
Seit vergangenem Monat sitzt der ehemalige Vorsitzende des Verwaltungsrats von Nissan Motor, Carlos Ghosn, in Tokio in Haft. Ghosn wird vorgeworfen, Teile seinen Einkommens nicht offengelegt zu haben. Dieser bestreitet die Vorwürfe laut japanischen Medien.
Ein Verkauf oder eine Teilveräusserung der grössten Sparte, Stromnetze, würde den Industriekonzern ABB weniger kapitalintensiv und dadurch rentabler machen.
Der Industriemulti ABB verdankt seinen Aufstieg zum Weltkonzern vor allem dem Geschäft mit Produkten für die Stromübertragung. In der Schweiz ist es bis heute das massgebliche Standbein – ein Verkauf würde grosse Wellen schlagen.
Die Rabattschlacht im November hat sich hierzulande erst seit ein paar Jahren etabliert. Doch die Tradition des Shopping-Wochenendes nach Thanksgiving hat in den USA schon im Jahr 1939 Präsident Franklin D. Roosevelt beschäftigt.
Der Ton zwischen den Vereinigten Staaten und China wird immer schärfer. Nicht nur ein Handelsstreit, sondern auch ein politischer oder gar militärischer Konflikt liegen in der Luft.
Italiens Regierung beharrt auf ihrem umstrittenen Haushaltsentwurf und riskiert damit ein Strafverfahren der EU. Der Konflikt könnte eskalieren – mit Auswirkungen auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
Der Rechtspopulist und pensionierte Militär Jair Bolsonaro hat die Präsidentschaftswahl in Brasilien gewonnen. Von den einen wird er als gefährlicher Diktaturnostalgiker bebrandmarkt, von den anderen als Kämpfer gegen Korruption und für eine Erneuerung der brasilianischen Gesellschaft gefeiert.
Grosszügige Ausgaben bei tieferen Einnahmen, so lautet die Zusammenfassung des Haushaltsentwurfs der italienischen Regierung aus Links- und Rechtspopulisten. Kann Brüssel das Euro-Land in die Schranken weisen?
Hauptbetroffen vom US-Handelsverbot gegenüber Iran sind europäische Firmen. Europäische Politiker wollen Trump die Stirn bieten und die in Iran tätigen Unternehmen schützen. Doch der Arm der USA ist lang. Viele Firmen lassen von sich aus die Finger von Iran.
Die Strafzölle, die US-Präsident Trump gegen die wichtigsten Handelspartner verhängt, haben einen Konflikt mit unabsehbaren Folgen ausgelöst. Nach Gegenmassnahmen der betroffenen Länder schaltet Trump jeweils eine Eskalationsstufe höher. Wie geht es weiter?
Vor 10 Jahren hat die Grossbank Staatshilfe in Anspruch nehmen müssen – und damit viel Vertrauen verloren. Dieses wieder aufzubauen, gelang erst nach einigen kommunikativen Fehlern.
Die Rettung der UBS hielt die Schweiz in Atem. Wie gerät ein Unternehmen in die Krise? Die UBS hat es vor einem Jahrzehnt vorexerziert. Eine Analyse.
Peter Kurer, der im Krisenjahr 2008 Verwaltungsratspräsident der UBS war, legt dar, wie die Grossbank an den Rand des Untergangs geriet, wie sie gerettet wurde und welche Fehler zu vermeiden gewesen wären.
Vor zehn Jahren wurde die UBS von Bund und Nationalbank in einer beispiellosen Hilfsaktion gerettet. Nach dem Konkurs von Lehman Brothers wollte man verhindern, dass mit der Schweizer Grossbank dasselbe geschieht.
Die UBS-Rettung vor zehn Jahren entpuppte sich als Erfolg. Ein Direktbeteiligter nennt vier Gründe, weshalb das riskante Vorhaben gelang.
Zehn Jahre nach ihrem Beinahe-Untergang ist die UBS wieder in der Spur. Aber die Zeiten, in denen sie zweistellige Milliardengewinne schrieb, sind endgültig vorbei.
Die NZZ hat ab dem 16. Oktober ausführlich und engagiert über die spektakuläre Rettung der UBS informiert. Hier die NZZ-Ausgaben der dramatischen Tage und die wichtigsten Artikel zu den Ereignissen.
An einem Freitagabend im September 2008 ruft der amerikanische Finanzminister Paulson die Chefs der US-Banken zusammen. Sie sollen Lehman Brothers retten. Ein Rückblick auf 48 dramatische Stunden.
Der Konkurs von Lehman Brothers 2008 riss die Märkte auf der ganzen Welt in die Tiefe. Manche fanden rasch zu alter Stärke zurück, andere brauchten Jahre – und die Aktienkurse der beiden Schweizer Grossbanken haben sich bis heute nicht erholt. Eine Übersicht.
Der Konkurs von Lehman Brothers 2008 brachte die globale Wirtschaftsordnung an den Rand des Kollapses. Heute ist das grundlegende Problem noch immer nicht gelöst.
Der Notenbankchef Thomas Jordan liefert einen raren Einblick in die Krisenpolitik der Schweiz nach dem Kollaps von Lehman Brothers. Im Interview mit der NZZ rechtfertigt er die UBS-Rettung: «Der Verlauf der Geschichte gab uns recht.»
In den USA entstand über Jahrzehnte ein toxischer Cocktail, der letztlich das gesamte Finanzsystem an den Rand des Abgrunds brachte. Finanzinstitute, Regulatoren, Politiker und Konsumenten – sie alle versagten im Kollektiv.
Die Bankenregulierung wurde in den vergangenen zehn Jahren enorm ausgebaut. Ob damit das Finanzsystem stabiler wurde, ist aber alles andere als klar.
Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession wird nicht grösser, nur weil ein Aufschwung schon sehr lange anhält. Ökonomische Expansionen, das zeigt die Geschichte, sterben nicht an Altersschwäche.
Bedeutet eine geringere Kapitaldeckung eine Gefahr für die Finanzstabilität? Ökonomen untersuchten Daten seit 1870. Ihre Ergebnisse sind überraschend. Der grösste Feind ist oft nicht die Regulierung, sondern eine mangelhafte Führung.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Die NZZ hat im Umfeld des Untergangs der Bank Lehman Brothers intensiv über den Fall und die dramatischen Probleme der US-Banken informiert. Hier die NZZ-Ausgaben der dramatischen Tage und die wichtigsten Artikel zu den Ereignissen.
Der Bankrott der Investmentbank Lehman ist das Symbol der Finanzkrise. Die Folgen für die Wirtschaft waren dramatisch.
Am 15. September 2008 bricht die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers zusammen – es war der Anfang einer globalen Finanzkrise.
Seit dem Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers verkünden manche das Ende des Liberalismus, andere setzen mit allen Mitteln auf strukturerhaltende Schadensbegrenzung. Beides ist falsch.
Vergessen ist der Banken-Crash vom Oktober 2008 in Island zwar nicht, aber immerhin verdaut. Zehn Jahre nach der grossen Krise geht es der Nordatlantikinsel besser als je zuvor. Nun lautet die Aufgabe, drohende Ungleichgewichte früh genug zu erkennen.
Zur Bewältigung der Finanzkrise haben viele Staaten fast ihr ganzes Pulver verschossen. Um geld- und fiskalpolitisch wieder Spielraum zu gewinnen, drängen sich Reformen auf. Was zu tun wäre, skizziert die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Mit Heinz Huber von der Thurgauer Kantonalbank hat Raiffeisen einen neuen Chef. Doch bei der Entsorgung der Altlasten gibt es noch viel zu tun. Worum geht es konkret? Ein Überblick.
Die Bankengruppe profitiert in personell stürmischen Zeiten von einem widerstandsfähigen Geschäftsmodell.
Der bisherige Chef der Basler Kantonalbank soll das Aufsichtsgremium der drittgrössten Bank im Land leiten. Gleichzeitig stehen vier weitere neue Mitglieder zur Wahl.
Mit der Nomination von Guy Lachappelle setzt der Verwaltungsrat von Raiffeisen ein deutliches Zeichen. Die Raiffeisenbanken wollen in St. Gallen mitreden, die Zeit der Solokünstler ist vorbei.
Guy Lachappelle musste bei der Basler Kantonalbank (BKB) einige Baustellen aufräumen. Imagemässig steht das Institut heute nun wieder besser da als noch vor einigen Jahren. Kann er als Präsident auch bei Raiffeisen etwas bewegen?
Pascal Gantenbein, Vizepräsident der Raiffeisen-Gruppe, führt im Gespräch aus, warum gerade Guy Lachappelle als neuer Präsident nominiert wurde. Eine ganze Reihe von Fähigkeiten habe den Ausschlag gegeben.
Daniel Libeskind ist bekannt für seine spektakuläre Architektur – nun will er auch im Sozialwohnungsbau für frischen Wind sorgen. Für Zürich wünscht er sich vor allem: mehr Diversität.
Das Internet macht den stationären Detailhändlern das Leben immer schwerer. Es gibt zwar Wege, die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, sie sind aber nicht offensichtlich.
SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg erklärt an den NZZ Real Estate Days, warum sein Institut den Liegenschaftenmarkt im Visier hat.
Seit Jahren befinden sich die internationalen Immobilienmärkte in einer hervorragenden Verfassung. Eine allzu grosse Unbekümmertheit könnte aber bestraft werden.
Die Teilnehmer der NZZ Real Estate Days haben ein Projekt mit Studentenwohnungen im Tessin zu ihrem Investment-Favoriten gekürt.
Der Staatsbetrieb hat alle Voraussetzungen, um das Hypothekengeschäft zu forcieren, sollte das Kreditvergabeverbot wegfallen. Gerade im jetzigen Umfeld könnte das gravierende Folgen haben.
Der Bundesrat will die Fesseln der Postfinance lockern. Er lässt eine Vorlage ausarbeiten, die es der viertgrössten Schweizer Bank erlaubt, Kredite und Hypotheken zu vergeben. Gleichzeitig will er das Aktionariat öffnen. Er sieht aber keine Privatisierung vor.
Der Bund präsentiert eine unausgegorene Lösung, um die vielfältigen Probleme des Finanzdienstleisters Postfinance zu lösen. Es gilt, den gordischen Knoten zu zerschlagen.
Mit den Postreformen privatisierte Berlin einst die Bundespost, aus der auch die Postbank hervorging. Doch bis heute fehlt es der früheren Staatsbank, die nun der Deutschen Bank gehört, an Effizienz.
Postfinance soll laut dem Bundesrat künftig Hypotheken und Kredite vergeben dürfen. Bis das Finanzinstitut zu einer privatisierten normalen Bank würde, dürften in jedem Fall noch Jahre vergehen.
Der Bundesrat will Postfinance neue Geschäftsfelder erlauben und private Aktionäre ins Boot holen. Doch die Pläne stossen bei den Parteien praktisch durchgehend auf Ablehnung.
Der Bundesrat möchte das Hypothekar- und Kreditverbot für Postfinance lockern und sie im Gegenzug teilprivatisieren. Fünf Fragen und Antworten dazu, was das heisst und bedeutet.
Nicht nur in der Akademie, sondern auch in der Öffentlichkeit: Das NZZ-Ranking zeigt, welche Ökonomen in der Schweiz wahrgenommen werden.
Aus der Schweiz haben nur zwei Ökonomen den Sprung über die Grenze geschafft: Ernst Fehr und Bruno S. Frey. Der Zürcher Verhaltensökonom Fehr setzt sich dafür gleich in beiden Ländern an die Spitze.
Insgesamt haben 38 Wirtschaftswissenschafter die Aufnahme in das Ranking geschafft. Bei den Institutionen baut die erstplatzierte Universität Zürich ihren Vorsprung weiter aus.
Die Digitalisierung pflügt die Wirtschaft um. Die Rede ist von der zweiten oder gar vierten industriellen Revolution. Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Revolution jedoch als jahrzehntelanger Strukturwandel.
In der Demokratie obliegen wichtige Entscheide der parlamentarischen Kontrolle. Das gilt jedoch nicht für Zentralbanken, die grosse Autonomie geniessen, um den Auftrag der Geldwertstabilität zu erfüllen. Doch der lauter werdende Vorwurf des Machtmissbrauchs könnte ihre Position gefährden.
Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius bleiben. Schweizer Durchschnittstemperaturen haben diese Grenze bereits überschritten, trotzdem steigt der Verbrauch fossiler Energien weiter. Dabei gäbe es eine einfache Antwort.
Wie lässt sich der Absatz von Produkten ankurbeln? Die Marketingspezialisten suchen immer wieder nach Mitteln und Wegen, wie sie die Konsumenten mehr zu Käufen animieren können. Zuweilen erscheinen ihre Methoden unheimlich. Dabei sind die einfachsten Rezepte die wirksamsten.
Ein Luzerner macht Karriere beim «Internetkonzern des 19. Jahrhunderts».
Amy Goldstein erzählt in «Janesville» die Geschichte von den Menschen in der Kleinstadt Janesville im Gliedstaat Wisconsin und wie sie damit umgehen, dass die Autofabrik in ihrem Ort die Tore schliesst.
Die Marke Regiofair hat sich in den vergangenen Jahren am Markt durchgesetzt. Die Initiative wurde von Biobauern der Zentralschweiz ergriffen, die beschlossen, ihre Produkte in Zukunft selber zu vermarkten. Heute erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von über 9 Milliarden Franken.
In den USA ist der Black Friday ein gewichtiger Shopping-Event, auch in Europa findet der Sonderverkauf vor Weihnachten immer mehr Anhänger. Die Rabattschlacht dient aber nicht nur den Kunden, sondern hilft auch den Verkäufern, ihre Ladenhüter loszuwerden.
Im Herbst 2009 verkündete die griechische Regierung, dass ihr Staatsdefizit doppelt so hoch wie geplant ausfallen werde. Damit begann die bis heute andauernde Krise. Eine Reise auf eine boomende Touristeninsel und in die geschundene Hauptstadt.
Am Montag, 29. Oktober (dem türkischen Nationalfeiertag), wird in Istanbul der neue Grossflughafen eröffnet. Das Projekt ist einer der gigantischen Infrastrukturbauten, mit denen sich der seit 2003 regierende Recep Tayyip Erdogan Denkmäler setzt.
Der frühere britische Premierminister John Major hält den EU-Austritt Grossbritanniens für einen Fehler. Europa muss sich auf die Hinterbeine stellen, um international eine bedeutende Rolle zu spielen.
China gewinnt auch an den Finanzmärkten massiv an Bedeutung. Es bleiben aber einige Herausforderungen, wie sich am diesjährigen Swiss International Finance Forum (SIFF) zeigt.
Investitionen auf soziale und ökologische Kriterien auszurichten, wird immer populärer. Viele versprechen sich davon höhere Renditen, wie am Podium des Swiss International Finance Forums deutlich wurde.
Brexit, China, Nachhaltigkeit – am Swiss International Finance Forum debattierten Experten aus der Finanzbranche und der Politik die brennendsten Fragen. Mit dabei waren unter anderen John Major, ehemaliger Premierminister Grossbritanniens und der Sicherheitsberater unter US-Präsident Obama, Ben Rhodes.
Was bedeutet Sustainable Finance für den Finanzplatz Schweiz? Welche Auswirkungen wird der Brexit haben und wie sieht die Zukunft der Banken in China aus? Am Swiss International Finance Forum debattieren Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik diese Fragen.
Migros, Coop oder die Mobiliar: Bedeutende Schweizer Konzerne sind als Genossenschaften organisiert. Kaum ein Firmengründer entscheidet sich heute aber noch für diese Gesellschaftsform. Warum ist das so?
Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und was es bei der Investition in Nebenwerte zu beachten gilt.
Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und was es beim Kauf dieses Wertpapiers zu beachten gilt.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Als grösste Überraschung im Prozess gegen die Grossbank UBS und die angeklagten Einzelpersonen in Paris entpuppte sich die mangelhafte Beweislage der Anklage. Die grosse Frage lautet, ob die Richter einen Entscheid unabhängig von der herrschenden politischen Stimmung treffen können.
Der Geschäftsführer des unter Druck stehenden VW-Konzerns gibt sich im Gespräch sicher, dass der geplante kompromisslose Vorstoss in die Elektromobilität dem Wolfsburger Konzern die Chance einräumt, den Dieselskandal vergessen zu machen. Von Fahrverboten für ältere Selbstzünder hält er nichts.
Der Sturz von Technologie-Titeln wie jenen von Facebook, Apple und Netflix könnte eine Baisse am Aktienmarkt eingeläutet haben. Was lässt sich aus dem derzeitigen monetären, konjunkturellen und charttechnischen Bild ableiten?


























