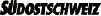
Der Volkswagen-Konzern wirbt dem Konkurrenten BMW dessen Einkaufschef Markus Duesmann ab. Der Aufsichtsrat habe entschieden, dem Manager einen Posten im Konzernvorstand anzubieten, teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit.
Die Fahrleitung der Zugstrecke über den Seedamm zwischen Rapperswil und Pfäffikon muss erneuert werden. Deswegen wird der öffentliche Verkehr monatelang zeitweise auf die Strasse verlegt.
Teilen statt Besitzen ist einer der grossen Trends der Zeit. Bei den Autos und Scootern gibt es dazu bereits Geschäftsmodelle. Nun überlegt sich auch der Flughafen Lugano, inwiefern Fluggäste sich auch Privatjets teilen könnten.
Es muss ein Riese gewesen sein - und er lebte auf sehr grossem Fuss: Fast einen Meter misst der Fuss eines in den USA gefundenen Dinosauriers - ein neuer Rekord.
Das Schweizer Team hat an der diesjährigen Internationalen Biologie-Olympiade in Iran eine starke Leistung gezeigt. Die Maturandin Jana Meier von der Kanti Wettingen gewann Gold, ihre drei Teamkollegen holten Bronze.
Es hatte so schön begonnen, doch nun scheint das Verhältnis zwischen Donald Trump und der Kult-Motorradschmiede Harley-Davidson zerrüttet. Grund ist der vom US-Präsidenten losgetretene Handelsstreit. Wie gefährlich ist der Konflikt für das US-Traditionsunternehmen?
Bald fällt der Entscheid, ob sich die Gemeinde Davos am GKB-Neubauprojekt beteiligt. Das Baugesuch liegt vor.
Der Agrochemiekonzern Syngenta, der vor einem Jahr Anfang vom chinesischen Staatsbetrieb ChemChina übernommen wurde, hat im ersten Halbjahr 2018 von deutlich besser laufenden Geschäften in Brasilien und China profitiert. Der Gewinn profitierte von Sondereffekten.
Lindt & Sprüngli hat in der ersten Jahreshälfte 7,7 Prozent mehr Lindorkugeln, Schokoladentafeln und Pralinés verkauft als im Vorjahr. Ohne Übernahmen und Wechselkurseffekte betrug das organische Umsatzplus 5,1 Prozent - damit ist Lindt auf dem Weg aus dem Formtief.
Selbst die höchste je von der EU verhängte Wettbewerbsbusse kann die Geldmaschine Google nicht aus der Bahn werfen. Der Mutterkonzern Alphabet verdaut die Strafe in einem Quartal und verdient dank sprudelnder Werbeeinnahmen trotzdem noch Milliarden.
Die Grossbank UBS hat im zweiten Quartal mehr verdient und damit die Erwartungen übertroffen. Mit Blick nach vorne bleibt das Institut verhalten optimistisch, warnt aber vor den Gefahren der geopolitischen Spannungen und des wachsenden Protektionismus.
Die Swisscom möchte alle Schweizer Gemeinden mit Breitbandanschluss versorgen. In Graubünden sollen bis 2021 108 Gemeinden an die digitale Autobahn angeschlossen werden.
Die vier Raiffeisenbanken See und Gaster haben ihre Zahlen für das erste Halbjahr vorgestellt. Hauptgeschäft sind weiterhin Hypotheken. Hier gab es ein Plus. Sparen ist für die Kunden dagegen wegen niedriger Zinsen unattraktiv. Davon profitiert oft die jüngere Generation.
Die flächendeckende Breitbandversorgung liegt im Kanton Graubünden fast im schweizerischen Mittel. Dennoch sind Übertragungsgeschwindigkeit, wie sie im Mittelland längst zum Standard gehören, im Münstertal, im Prättigau, im Oberengadin oder in der obersten Surselva auch weiterhin eine Traumvorstellung.
Der Elektroautobauer Tesla steht nach einem Bericht über angebliche finanzielle Hilfsersuchen bei Zulieferern an der Börse unter Druck. Die Aktie startete am Montag mit einem Minus von mehr als vier Prozent in den Handel.
Der neue Fiat-Chrysler-Chef Mike Manley tritt ein schwieriges Erbe an.
Schweizer Studierende haben erneut am Hyperloop-Wettbewerb des Milliardärs Elon Musk in Kalifornien teilgenommen. Das Team der ETH Lausanne, EPFLoop, belegte am Sonntag in der Stadt Hawthorne von den 18 Teilnehmermannschaften den dritten Platz.
Ryanair wird von Streiks des fliegenden Personals durchgeschüttelt. Die Auswirkungen sind schon in den Geschäftszahlen abzulesen. Es kann aber noch heftiger werden.
Der niederländische Gesundheitskonzern Philips hat wegen Wertberichtigungen im zweiten Quartal weniger verdient.
Die Julius Bär Gruppe hat im ersten Semester 2018 von weiteren Geldzuflüssen und von Fortschritten auf der Kostenseite profitiert und die Gewinnzahlen erneut gesteigert.
Die AGD Swiss Plastic AG feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Die Kunststofffabrik in Walenstadt hat sich in kürzester Zeit zu einem der weltweit grössten Hersteller für Schokoladenformen entwickelt.
US-Finanzminister Steven Mnuchin hat kurz vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten in Buenos Aires die Forderung nach fairen Chancen für sein Land im Handel mit China und der EU bekräftigt.
Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne muss die Führung des italienisch-amerikanischen Autobauers aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Nach einer Schulteroperation sei es zu unerwarteten Komplikationen gekommen, teilte Fiat Chrysler am Samstag mit.
Mit einer 64-seitigen Spezialausgabe und schlicht gehaltener Todesanzeige auf der Titelseite nimmt die grösste Westschweizer Tageszeitung «Le Matin» Abschied von ihrer Leserschaft. Eine samstägliche Dernière voller Emotionen und Trauer.
Erneute Reisewelle auf der Strasse in den Süden: Nördlich des Gotthardtunnels auf der Autobahn A2 in Uri stauen sich die Fahrzeuge auf noch sieben Kilometern.
Die Bündner Regierung hatte Beschwerden gegen eine neue Bike-Strecke abgewiesen. Der Streit könnte bis vor Bundesgericht führen.
Zehntausende Dokumente mit sensiblen Daten grosser Autohersteller sind laut einem Zeitungsbericht vorübergehend öffentlich im Internet aufgetaucht. Betroffen waren Branchengrössen wie VW, Toyota, GM, Ford, Fiat Chrysler und Tesla, wie die «New York Times» berichtet.
In den USA ist der Buchverkauf online im vergangenen Jahr erstmals mit dem analogen Handel gleichgezogen. Wachsender Beliebtheit erfreuten sich vor allem Hörbücher. Insgesamt wurden im letzten Jahr in den USA 2,72 Milliarden Bücher verkauft.
In Russland ist ein Gulag-Museum zur Schliessung gezwungen worden. Der Museumsdirektor hält den Schritt für politisch motiviert, weil die Aufarbeitung von stalinistischen Verbrechen zunehmend unerwünscht ist. Die Behörden erklärten, am Gebäude gebe es bauliche Mängel.
Die Hartmann-Gruppe verlässt den Graubündnerischen Baumeisterverband, wie Recherchen von RTR gezeigt haben. Die 600 Mitarbeiter starke Firma, will den Mitgliederbeitrag von 200'000 Franken pro Jahr lieber in die eigene Stärkung investieren.

Die USA und die EU nähern sich im Streit um Industriezölle an. US-Präsident Trump und EU-Kommissions-Präsident Juncker verkündeten nach ihrem Treffen in Washington eine Einigung in wesentlichen Punkten.
Die USA und die EU betonen ihr grundsätzliches Interesse am Abbau von Zöllen – und beide tun das Gegenteil. Ist «TTIP light» ein Ausweg?
Mit Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne verliert die Wirtschaftswelt einen der charismatischsten und erfolgreichsten Manager der letzten beiden Dezennien, der auch in der Schweiz nachhaltige Spuren hinterlassen hat. Ein Nachruf.
An diesem Mittwoch besucht der EU-Kommissions-Präsident den US-Präsidenten Trump. Was er vorbringen wird – und wie gross die Chancen sind.
Der Kiosk- und Brezelkonzern muss sein Imperium verteidigen. Die SBB schreiben 265 Flächen an Bahnhöfen aus, und Valora drohen im schlimmsten Fall ein Fünftel ihrer Standorte in diesem Bereich abhandenzukommen. Das soll mit einem neuen Konzept verhindert werden.
Deutschlands grösstes Geldhaus will berechenbarer und deshalb weniger abhängig vom Investment Banking werden. Doch im zweiten Quartal steuerte diese Einheit trotz mässiger Performance einmal mehr fast 60% zum Vorsteuergewinn bei.
Wer kennt sie nicht, die opulenten Tafelservices und Einzelstücke mit den gekreuzten Schwertern aus Meissener Porzellan? Doch die letzten Jahre waren miserabel. Mit Millionen vom Staat nimmt die Traditionsfirma einen neuen Anlauf.
Mit Holdings und (Teil-)Börsengängen wollen sich Konzerne der Autobranche und anderer Sektoren fit für die Zukunft machen. Ein Vorreiter der Entwicklung war Siemens. Doch nicht immer sorgt die Trennung für einen Mehrwert für die Aktionäre.
Ist es die Flüchtlingskrise oder die Altersarmut, um die sich deutsche Politiker mehr kümmern sollten? Zwei Meinungsumfragen von letzter Woche kommen zu völlig unterschiedlichen Resultaten. Woran liegt das?
Der Chemie- und Pharma-Zulieferkonzern hat für das erste Halbjahr glanzvolle Zahlen vorgelegt und nimmt dies zum Anlass, die selbst gesteckten Ziele nach oben anzupassen.
Schon wieder neue Abgas-Manipulation bei europäischen Auto-Herstellern? Zahlen der EU-Kommission legen das zumindest nahe. Die deutsche Autoindustrie weist die Vorwürfe zurück.
Die EU-Kommission hat gegen Asus, Philips, Pioneer sowie Denon & Marantz Bussen in Höhe von insgesamt über 111 Mio. € verhängt. Sie wirft den Firmen vor, Online-Detailhändlern illegalerweise Fest- oder Mindestpreise vorgegeben zu haben.
Der Tourismusmanager Daniel Renggli hat in seinen Betrieben in der Lenzerheide viele Traditionen der Gästebetreuung über Bord geworfen.
Die Online-Möbelfirma Beliani setzt auf internationales Wachstum im Internet und kooperiert mit der Konkurrenz. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich auch sonst von demjenigen herkömmlicher Möbelhändler.
Die Strafzölle, die US-Präsident Trump gegen die wichtigsten Handelspartner verhängt, können einen Konflikt mit unabsehbaren Folgen auslösen. China und die EU reagieren mit Gegenmassnahmen und auch die Schweiz ist an die WTO gelangt. Droht jetzt ein Handelskrieg?
Die Zürcher Privatbank hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Gewinn geschrieben. Die Integration der vor Jahresfrist erworbenen BSI verursacht Kosten..
Sergio Marchionne, der langjährige Chef des Autobauers Fiat-Chrysler, ist 66-jährig gestorben. Bei einer Operation gab es offenbar unerwartete Komplikationen. Marchionne hat auch namhafte Schweizer Unternehmen nachhaltig geprägt.
Die Unterwäscheherstellerin Calida musste im zweiten Halbjahr ein schlechteres Betriebsergebnis sowie einen markanten Gewinneinbruch hinnehmen. Das Unternehmen plant erhebliche Investitionen in den Online-Vertrieb.
Mitten im vom neuen Konzernchef verordneten Umbau schreibt das grösste deutsche Geldhaus im zweiten Quartal zwar schwarze Zahlen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sinkt der Nettogewinn allerdings deutlich.
Der Chemiekonzern hat im ersten Semester beim Umsatz und bei den Gewinnen deutlich zugelegt. Die Betriebsmarge liegt indessen immer noch unter dem mittelfristig angestrebten Ziel.
Die Einzelhandelsgruppe Valora konnte in der ersten Jahreshälfte 2018 Umsatz und Betriebsgewinn steigern. Abschreibungen auf nicht fortgeführten Geschäften drückten jedoch auf den Reingewinn.
Der Industriekonzern Sulzer steigert im ersten Halbjahr 2018 Umsatz, Gewinn und Auftragseingang. Trotz dem etwas gemächlicheren Tempo im zweiten Quartal erhöht Sulzer die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018.
Die Industriegruppe Bucher Industries hat im ersten Halbjahr 2018 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Alle Divisionen leisteten hierzu ihren Beitrag. Rückenwind kam zudem von der Währungsentwicklung. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.
Die Kundenberaterin in einer Bank glaubte schon, der Arbeitstag könne nicht mehr schlimmer werden. Doch sie sollte sich irren.
Die Strafzölle, die US-Präsident Trump gegen die wichtigsten Handelspartner verhängt, können einen Konflikt mit unabsehbaren Folgen auslösen. China und die EU reagieren mit Gegenmassnahmen und auch die Schweiz ist an die WTO gelangt. Droht jetzt ein Handelskrieg?
Raiffeisen steckt in starken Turbulenzen. Mitten in der Aufarbeitung der Vincenz-Affäre tritt auch Konzernchef Patrik Gisel zurück. Worum geht es konkret und wie geht es bei der Bankengruppe weiter? Ein Überblick.
Die Digitalwährung Bitcoin hat seit dem Jahresanfang fast die Hälfte ihres Werts verloren. War der frühere Hype nur heisse Luft, eine Spekulationsblase oder gar Manipulation? Die wichtigsten Antworten.
Aufruhr im Autoland Deutschland: Zunächst erschütterte der Dieselskandal um manipulierte VW-Motoren die Öffentlichkeit. Jetzt gerät nach Volkswagen auch die Konzerntochter Audi ins Visier der Ermittler. Wir liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Die britische Finanzaufsicht schlägt vor, Banken die Erhebung verschiedener Zinsen für verschiedene Sparer zu verbieten. Auch wenn die derzeitigen Zinsen wenig attraktiv sind: Das wäre ein zu grosser Eingriff.
Der Internationale Währungsfonds vergleicht die Hyperinflation in Venezuela mit der Weimarer Republik im Krisenjahr 1923. Der Vergleich ist berechtigt. Doch Venezuelas Präsident Maduro ist nicht willens, die Lehren daraus zu ziehen.
Das Reich der Mitte wird immer wohlhabender. Und dennoch stellen Krebserkrankungen viele Chinesen vor unlösbare finanzielle Probleme. Ein Film über eine wahre Begebenheit sorgt nun für heftige Diskussionen in China.
Tesco plant ein neues Retail-Format. Das Unternehmen versucht sich gegen Aldi und Lidl durchzusetzen.
Lindt & Sprüngli investiert die stolze Summe von 200 Mio. Fr. in den Standort USA. Dabei sind die Wachstumsaussichten in Amerika doch alles andere als rosig.
Die lange Streikserie französischer Fluglotsen richtet einen grossen Schaden an. Vier europäische Luftfahrtgesellschaften reichen bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde ein und pochen auf die Reisefreiheit.
Ausländische Konkurrenz, verschärfter Preisdruck und Verdrängungswettbewerb: Es sind nicht gerade einfache Zeiten für Schweizer Möbelhändler. Nun werden sie auch noch vermehrt von reinen Online-Anbietern bedrängt.
Kaum eine Schweizer Gemeinde ist derart abhängig von einem einzelnen Unternehmen wie das Oberwalliser Städtchen Visp. Die Chemiegruppe Lonza ist der dominierende Arbeitgeber und Steuerzahler.
In diesem Jahrhundert durchlitt Irland bereits eine Immobilienkrise, eine Bankenkrise, eine Schuldenkrise und eine Wirtschaftskrise. Jetzt schiessen die Wohnungspreise wieder in die Höhe, aber nicht wegen Spekulation.
Zur Bewältigung der Finanzkrise haben viele Staaten fast ihr ganzes Pulver verschossen. Um geld- und fiskalpolitisch wieder Spielraum zu gewinnen, drängen sich Reformen auf. Was zu tun wäre, skizziert die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Die Europäische Zentralbank will Ende des Jahres ihre massiven Anleihekäufe beenden. Kurzfristig rücken nun die Folgen des Handelskrieges auf die Konjunktur in den Mittelpunkt, langfristig die Entwicklung der eigenen Bilanzsumme und der Zinsen.
Seit die Finanzkrise den Sektor und das Bankgeheimnis erschüttert hat, ist der Schweizer Bankensektor im Umbruch. Die Veränderungen sind strukturell.
Kurz vor einer wichtigen Sitzung von Japans Notenbank wetten die Anleger auf Korrekturen bei der ultralockeren Geldpolitik. Doch Experten rechnen noch nicht mit einer Zinsanhebung.
Vier europäische Airlines haben bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen Frankreich deponiert. Die Verweigerung von Überflügen wegen Fluglotsenstreiks verstosse gegen die Reisefreiheit, wird argumentiert.
Der Konflikt um Zölle zwischen den USA, Europa und China dominiert das G-20-Treffen in Buenos Aires. Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer warnen vor den wirtschaftlichen Risiken eines Handelskriegs.
US-Präsident Trump hat mit gezielten Interventionen bewirkt, dass Pharmafirmen von Preiserhöhungen absehen – zumindest für eine gewisse Zeit. Ob sich damit die Strukturprobleme des US-Gesundheitsmarkts beheben lassen, ist allerdings fraglich.
Bisher galt Singapur auch bezüglich Cyberabwehr als hochgerüstet. Ein Hackerangriff hat nun gezeigt, dass der Stadtstaat durchaus verwundbar ist. Auch Fichen des Premierministers sind gestohlen worden.
Die UBS hat den Gewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. In der globalen Vermögensverwaltung musste die Grossbank aber einen Abfluss von Geldern hinnehmen.
Der Schokoladehersteller Lindt & Sprüngli ist im ersten Semester kräftig gewachsen und hat auch die Profitabilität deutlich verbessert. Herausgefordert ist das Unternehmen besonders in den USA, wo man nun viel Geld in neue Anlagen investieren will.
Die Schweiz ist für gut qualifizierte, international ausgerichtete Arbeitskräfte attraktiv. Gerade den Lebenspartnern fällt die Integration aber oftmals schwer.
Die Motorrad-Kultmarke Harley-Davidson kommt nicht mehr recht voran. Die Verkäufe gehen zurück, auch weil die Stammkundschaft altert. Um den Zöllen der EU zu entgehen, verlagert das Unternehmen einen Teil der Produktion und zieht damit Trumps Zorn auf sich.
Opel schreibt seit zwanzig Jahren auf Jahressicht Verluste. Nun gab es im ersten Semester offenbar einen Gewinn. Schafft der neue Besitzer, der französische PSA-Konzern, doch die Wende?
Heinz Herren räumt Anfang 2019 seinen Posten als Leiter des Bereichs IT, Netzwerk und Infrastruktur bei Swisscom. Auf die Schlüsselstelle im Telekomkonzern rückt mit Christoph Aeschlimann ein Externer nach.
Der überstürzte Abgang von Sergio Marchionne verunsichert die Investoren. Die Wahl des Nachfolgers Mike Manley wird von den Branchenkennern jedoch begrüsst.
Hauptbetroffen vom US-Handelsverbot gegenüber Iran sind vorwiegend europäische Firmen. Die Europäer wollen Trump in die Stirn bieten und die in Iran tätigen Firmen schützen.
Mit einer Reihe von Massnahmen kontert die EU die von US-Präsident Trump angrkündigten Iran-Sanktionen. Europäische Unternehmen sollen weiterhin mit Iran geschäften können. Wunder darf man von der EU-Gegenwehr indessen nicht erwarten.
Die EU-Kommission will am Freitag den Prozess zur Reaktivierung einer Verordnung zur Abwehr amerikanischer Iran-Sanktionen formell lancieren. Ziel ist der Schutz kleinerer und mittlerer Unternehmen in der EU.
Solange Iran sein Atomprogramm eingefroren lässt, wollen die Europäer an der Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen festhalten. Die hierzu diskutierten Massnahmen weisen aber Schwächen auf.
Spätestens ab dem 4. November soll das US-Sanktionenregime gegenüber Iran wieder voll greifen. Betroffen dürften vor allem europäische Firmen sein.
Die Vereinigten Staaten haben wieder Sanktionen gegen Iran eingeführt – gegen den Willen ihrer europäischen Verbündeten. Washington versucht die Strafmassnahmen weltweit durchzusetzen. Der beste Erfüllungsgehilfe dabei ist der Dollar.
In Schweizer Wirtschaftskreisen stellt man sich die bange Frage, ob Geschäfte mit Iran weiterhin vertretbar sind. In den beiden Jahren seit der Aufhebung der Sanktionen ist der erhoffte Boom ausgeblieben.
Der Ärger über die Amerikaner ist gross. Die Aussicht, dass deutsche Firmen auf Sanktionslisten der Amerikaner landen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben, wird von Politik und Wirtschaft als anmassend empfunden.
China ist der weltgrösste Rohölimporteur. Gelingt es dem Reich der Mitte, seine Bezüge künftig mit Yuan zu zahlen, stärkte dies die Landeswährung auf Kosten des Dollars.
Einst schätzten die USA Iran als verlässlichen Bündnispartner. Doch seit 1980 bestehen zwischen den beiden Ländern keine diplomatischen Beziehungen mehr. Was ist passiert?
Fast jede Schweizer Firma muss sich ans neue Datenschutzgesetz der EU halten. Dem Einzelnen verschafft es mehr Transparenz. Machen es die Firmen geschickt, resultiert daraus mehr als nur ein bürokratischer Mehraufwand.
Seit Freitagmorgen gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Obwohl das so überraschend wie Weihnachten daherkommt, haben einige Website-Betreiber ihren Dienst (temporär) dichtmachen müssen.
Adrian Lobsiger ist seit bald zwei Jahren ein pragmatischer eidgenössischer Datenschützer. Dass die Schweiz der EU ab diesem Freitag beim Datenschutz hinterherhinkt, macht ihm Sorge.
Die Facebook-Affäre um Cambridge Analytica und die EU-Datenschutzverordnung haben das Thema Datensicherheit in den Vordergrund gerückt. Doch damit haben sie einen anderen Aspekt verdrängt.
Lange haben die Amerikaner einen laschen Umgang mit ihren Daten hingenommen. Fälle wie Cambridge Analytica haben das Thema Datenschutz jedoch in die Öffentlichkeit gebracht. Das neue Datenschutzgesetz der EU allerdings nur bedingt als Vorbild.
Ab 25. Mai gilt die neue Datenschutzverordnung der EU, die den Bürgern die Kontrolle über ihre persönlichen Daten im digitalen Raum zurückgeben will. Was bringt die Reform den Nutzern konkret? Und was bedeutet sie für europäische Unternehmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.
Wen betrifft die Datenschutz-Grundverordnung, welche Änderungen bringt sie, und warum kommt sie?
Kaum ein Schweizer Unternehmen, das nicht vom neuen Datenschutzgesetz betroffen ist, das nächsten Mai in der EU zur Anwendung kommt. Die Regulierung zwingt Firmen, den Datenschutz ernst zu nehmen.
Im Hinblick auf die bald deutlich schärferen EU-Datenschutzregeln passen Social-Media-Dienste wie Facebook, Whatsapp oder Twitter jetzt ihre Dienste, Hausregeln und Alterslimiten an.
Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius bleiben. Schweizer Durchschnittstemperaturen haben diese Grenze bereits überschritten, trotzdem steigt der Verbrauch fossiler Energien weiter. Dabei gäbe es eine einfache Antwort.
Wie lässt sich der Absatz von Produkten ankurbeln? Die Marketingspezialisten suchen immer wieder nach Mitteln und Wegen, wie sie die Konsumenten mehr zu Käufen animieren können. Zuweilen erscheinen ihre Methoden unheimlich. Dabei sind die einfachsten Rezepte die wirksamsten.
Ein Luzerner macht Karriere beim «Internetkonzern des 19. Jahrhunderts».
Amy Goldstein erzählt in «Janesville» die Geschichte von den Menschen in der Kleinstadt Janesville im Gliedstaat Wisconsin und wie sie damit umgehen, dass die Autofabrik in ihrem Ort die Tore schliesst.
Bei Kirchenvätern hat das Finanzsystem keinen guten Ruf. Machen Christen, die ein sittliches Leben führen wollen, daher besser einen Bogen um die Welt der Geldwirtschaft?
Braucht ein Finanzsystem in einer digitalen Welt überhaupt noch Banken? Oder wäre dieses System nicht stabiler ohne traditionelle Geldhäuser? Ein neues Buch gibt Auskunft.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und weshalb die wichtigsten Währungen heute nicht mehr ans Gold gebunden sind.
In der Ukraine gehört Gleb Lukyanenko zu den Vorreitern in der Bio-Landwirtschaft. Ein Grossteil seiner Produkte wird in die Schweiz verkauft.
Migros, Coop oder die Mobiliar: Bedeutende Schweizer Konzerne sind als Genossenschaften organisiert. Kaum ein Firmengründer entscheidet sich heute aber noch für diese Gesellschaftsform. Warum ist das so?
Die europäische Wirtschaftswelt wird spätestens 1997 auf Sergio Marchionne aufmerksam, als der Italokanadier die Geschäfte der Alusuisse-Lonza-Gruppe übernimmt. Jetzt ist er frühere Fiat-Chrysler Chef 66-jährig gestorben.
Bei der Farnborough International Air Show, einer der wichtigsten Messen der Luft- und Raumfahrt, geht es um Milliardenaufträge. Vor allem zwischen Boeing und Airbus gibt es jeweils ein Rennen um die meisten Aufträge.
Die einen befürworten Wohnbaugenossenschaften als Bollwerke gegen Immobilienspekulation, die anderen sehen darin eine fragwürdige Bevorteilung einer kleinen Gruppe durch die öffentliche Hand. Doch welche Gebäude gehören in Zürich überhaupt Genossenschaften?
Rechnet man die gesamten Schulden eines Landes zusammen, also neben denjenigen des Staates auch die der Firmen, Haushalte und des Finanzsektors, ergibt sich eine eher unerwartete Rangliste – in der auch die Schweiz auftaucht.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Die Kaufkraft der Schweizer Währung ist in den letzten Monaten aufgrund der «jüngsten Frankenschwäche» auf hohem Niveau meist nur leicht gesunken. Die Türkei ist wegen der schwachen Lira eine Ausnahme.
Der Franken hat in jüngerer Zeit zum Euro wieder etwas zugelegt. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem die anhaltend «südeuropäische» Strategie der Europäischen Zentralbank.
Die Schweizerische Nationalbank bleibt dabei: Sie betrachtet den Franken ungeachtet der jüngsten Abschwächung als «hoch bewertet». Diese Einschätzung machte Notenbankchef Thomas Jordan an der Generalversammlung der Notenbank.


























