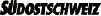
US-Finanzminister Steven Mnuchin hat kurz vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten in Buenos Aires die Forderung nach fairen Chancen für sein Land im Handel mit China und der EU bekräftigt.
Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne muss die Führung des italienisch-amerikanischen Autobauers aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Nach einer Schulteroperation sei es zu unerwarteten Komplikationen gekommen, teilte Fiat Chrysler am Samstag mit.
Mit einer 64-seitigen Spezialausgabe und schlicht gehaltener Todesanzeige auf der Titelseite nimmt die grösste Westschweizer Tageszeitung «Le Matin» Abschied von ihrer Leserschaft. Eine samstägliche Dernière voller Emotionen und Trauer.
Erneute Reisewelle auf der Strasse in den Süden: Nördlich des Gotthardtunnels auf der Autobahn A2 in Uri stauen sich die Fahrzeuge auf noch sieben Kilometern.
Die Bündner Regierung hatte Beschwerden gegen eine neue Bike-Strecke abgewiesen. Der Streit könnte bis vor Bundesgericht führen.
Zehntausende Dokumente mit sensiblen Daten grosser Autohersteller sind laut einem Zeitungsbericht vorübergehend öffentlich im Internet aufgetaucht. Betroffen waren Branchengrössen wie VW, Toyota, GM, Ford, Fiat Chrysler und Tesla, wie die «New York Times» berichtet.
In den USA ist der Buchverkauf online im vergangenen Jahr erstmals mit dem analogen Handel gleichgezogen. Wachsender Beliebtheit erfreuten sich vor allem Hörbücher. Insgesamt wurden im letzten Jahr in den USA 2,72 Milliarden Bücher verkauft.
In Russland ist ein Gulag-Museum zur Schliessung gezwungen worden. Der Museumsdirektor hält den Schritt für politisch motiviert, weil die Aufarbeitung von stalinistischen Verbrechen zunehmend unerwünscht ist. Die Behörden erklärten, am Gebäude gebe es bauliche Mängel.
Die Hartmann-Gruppe verlässt den Graubündnerischen Baumeisterverband, wie Recherchen von RTR gezeigt haben. Die 600 Mitarbeiter starke Firma, will den Mitgliederbeitrag von 200'000 Franken pro Jahr lieber in die eigene Stärkung investieren.
In den letzten fünf Jahren ist die Schweizer Arbeitswelt weiblicher geworden. Weil vermehrt Frauen wieder in die Arbeitswelt eingestiegen sind, hat sich ihr Anteil am Schweizer Arbeitsmarkt erhöht.
Der Pharmakonzern Roche folgt Konkurrenten wie Pfizer, Merck und Novartis und wird für den Rest des Jahres keine Preiserhöhungen in den USA durchführen. Dies erklärte eine Roche-Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Der französische Luxusgüterkonzern Hermes profitiert von einer ungebremsten Nachfrage aus China. Im ersten Halbjahr dürfte sich der operative Gewinn deshalb in Reichweite zum Rekordniveau des Vorjahreszeitraums bewegen.
Die Finanzmarktaufsicht Finma hat das letzte Verfahren im Zusammenhang mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB abgeschlossen. Dabei ging es um das Verfahren gegen die Rothschild Bank AG und ihre Töchter.
Die Anzahl Firmenkonkurse in der Schweiz ist im Juni gegenüber dem Vorjahr massiv gesunken. Insgesamt wurde über 412 Firmen ein Insolvenzverfahren eröffnet.
Die internationalen Sanktionen lassen die Konjunktur Nordkoreas so stark einbrechen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die südkoreanische Zentralbank (BOK) schätzte am Freitag, dass das Bruttoinlandprodukt im Nachbarland 2017 um 3,5 Prozent geschrumpft sei.
Nun ist es definitiv: Der Spielwarenhändler Franz Carl Weber erhält neue Besitzer. Es kommt wie erwartet zu einem Management-Buy-Out der Traditionsmarke.
Eine Reise zu einem Planeten ausserhalb unserer Sonnensystems würde 6300 Jahre dauern. Forscher haben berechnet, wie gross die Besatzung für so eine generationenübergreifende Reise sein müsste: Es wären demnach mindestens 49 Paare nötig.
Die Pegel der Gewässer sinken. Der Kanton Thurgau hat deshalb ein Wasserentnahmeverbot verhängt. Auch in St. Gallen wird ein solches Verbot diskutiert. Nicht in Graubünden – noch nicht.
Das Davoser Elektrizitätswerk erstellt den ersten Wärmeverbund im Ort. Genutzt wird eine Grundwasser-Wärmepumpe. Die Heizöleinsparungen sind enorm.
Die Trockenheit macht den Bündner Älplern zu schaffen. Vor allem dem Futterbau setzt die lange regenlose Periode zu. Notverkäufe und Futterzukäufe könnten Entlastung bringen.
Die scharfe Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Preisen der Pharmakonzerne zeigt immer mehr Wirkung. Der US-Hersteller Merck kündigte am Donnerstag an, den Preis für das Hepatitis-Medikament Zepatier um 60 Prozent zu senken.
Das Cloud-Geschäft und die Bürosoftware Office 365 haben Microsoft zu einem überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwachs verholfen. Die Erlöse des weltgrössten Softwareanbieters stiegen im vierten Quartal um 17,5 Prozent auf 30,1 Milliarden Dollar.
Müsste die Schweiz im Notfall ohne Importe auskommen, wäre die Selbstversorgung der Bevölkerung gewährleistet. Allerdings müssten die Menschen den Gürtel enger schnallen. Pro Tag und Einwohner gäbe es höchstens 2340 Kilokalorien.
Das neue Airbus-Transportflugzeug BelugaXL ist zu seinem Jungfernflug gestartet. Es handelt sich um das Nachfolgermodell für die Lastesel des europäischen Flugzeugbauers.
Stink-Premiere im Weltraum: Thailand hat zum ersten Mal die Stinkefrucht Durian ins All geschickt. Insgesamt wurden vier Exemplare mit einer privaten US-Rakete in den Weltraum befördert.
Das Selbstwertgefühl kann kurzfristig schwanken. Über die ganze Lebensspanne hinweg steigt die Selbstachtung laut einer Berner Studie aber an. Selbst in der Pubertät sinkt sie nicht - anders als bisher vermutet.
Kardiologen des Universitäts-Kinderspitals Zürich haben einem 24 Tage alten Baby einen neuartigen Stent implantiert. Die Gefässstütze wird mit dem Kind mitwachsen, was spätere Operationen überflüssig machen sollte.
Die Landsgemeinde im Mai 2010 hat ein Mehrjahresprogramm für den Strassenbau bis 2019 genehmigt. Von den neun Projekten sind acht schon fertig oder in Planung. Nur ein Neubauprojekt in Glarus wurde noch nicht angegangen. Die Gemeinde Glarus prüft jetzt Alternativen.
Immer mehr Menschen in der Schweiz sind mit Elektorfahrzeugen unterwegs. Deshalb möchte der Kanton Graubünden nun bei den Ladestationen aufrüsten. Angetrieben wird das Projekt von der Rhätischen Bahn und von Repower.
Der Autobauer Volvo ist im zweiten Quartal dank einer hohen Nachfrage in allen wichtigen Märkten deutlich gewachsen.

Bei der Google-Mutter Alphabet laufen die Geschäfte dank boomender Werbeerlöse weiter glänzend, die Rekordstrafe der EU-Kommission belastet jedoch den Quartalsgewinn. In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Überschuss im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zurück.
Der krankheitsbedingt erzwungene Wechsel an der Spitze von Fiat-Chrysler passt zum Trend in Europas Autobranche. Bei vielen Konzernen kommen jüngere Manager ans Ruder. Auf die «Next Generation» warten grosse Herausforderungen.
Der überstürzte Abgang von Sergio Marchionne verunsichert die Investoren. Die Wahl des Nachfolgers Mike Manley wird von den Branchenkennern jedoch begrüsst.
Der französische IT-Dienstleister Atos baut mit der Übernahme von Syntel seine Präsenz in den Vereinigten Staaten aus. Die Halbjahresergebnisse zeigen, dass es sich dabei um einen schwierigen Markt handelt.
Seit die Finanzkrise den Sektor und das Bankgeheimnis erschüttert hat, ist der Schweizer Bankensektor im Umbruch. Die Veränderungen sind strukturell.
Die grösste Billigfluggesellschaft Europas scheint im Arbeitskampf mit ihren Angestellten den Kürzeren zu ziehen.
Der Konflikt um Zölle zwischen den USA, Europa und China dominiert das G-20-Treffen in Buenos Aires. Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer warnen vor den wirtschaftlichen Risiken eines Handelskriegs.
US-Präsident Trump hat mit gezielten Interventionen bewirkt, dass Pharmafirmen von Preiserhöhungen absehen – zumindest für eine gewisse Zeit. Ob sich damit die Strukturprobleme des US-Gesundheitsmarkts beheben lassen, ist allerdings fraglich.
Der Gesundheitszustand des langjährigen CEO hat sich offenbar sehr plötzlich rapide verschlechtert. Die Nachfolge übernimmt Louis Camilleri.
Die Privatbank hat in den ersten sechs Monaten besser verdient und neue Gelder angezogen. Verbesserungspotenzial besteht am ehesten auf der Kostenseite.
Der neue Chef der aufstrebenden Ostschweizer Industriegruppe VAT, Michael Allison, gibt sich Mühe, sich in seinem neuen Umfeld schnell zu integrieren. Die gegenwärtige Wachstumsabschwächung im Halbleitersektor lässt ihn nicht unruhig werden.
Beamte, die zwar einen Lohn beziehen, aber nie im Büro auftauchen – das ist in afrikanischen Staatsdiensten ein verbreitetes Problem. Immer wieder versuchen Regierungen, diesen teuren Missbrauch radikal zu unterbinden, aber die Massnahmen sind meist von kurzer Dauer.
Schweden und Norwegen sind so trocken wie kaum je in den letzten 75 Jahren. In Schweden will Landwirtschaftsminister Bucht deshalb nicht nur den Staatshaushalt, sondern auch die Krisen-Reserven der EU anzapfen. Norwegen hingegen muss sich selbst zu helfen wissen.
Bisher galt Singapur auch bezüglich Cyberabwehr als hochgerüstet. Ein Hackerangriff hat nun gezeigt, dass der Stadtstaat durchaus verwundbar ist. Auch Fichen des Premierministers sind gestohlen worden.
US-Präsident Donald Trump hat der EU mit neuen Zöllen gedroht. Doch sein Finanzminister Steve Mnuchin zeigt sich beim G-20-Treffen in Buenos Aires gesprächsbereit.
Raiffeisen steckt in starken Turbulenzen. Mitten in der Aufarbeitung der Vincenz-Affäre tritt auch Konzernchef Patrik Gisel zurück. Worum geht es konkret und wie geht es bei der Bankengruppe weiter? Ein Überblick.
Der Logistikkonzern Ceva hat im ersten Halbjahr die Margen leicht verbessert. Die Emission von Notes zielt auf eine Verbesserung der Finanzierungsstruktur ab.
Lockheed soll dort die neue Weltraumfähre «Orion» präsentieren. Weitere US-Ausstellungsstücke: Ein Kampfjet, Jeans, Pickup-Wagen von Ford, getrocknete Rindfleischstreifen, Snowboards, Keksausstecher und Waffenschränke.
Die Schweiz nimmt als Gast am G-20-Treffen in Buenos Aires teil. Am Vorabend warnte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, vor einer Eskalation des Handelsstreits.
Zehntausende von Dokumenten mit sensiblen Daten grosser Autohersteller sind laut einem Bericht der «New York Times» vorübergehend öffentlich im Internet aufgetaucht.
Die schwedische Telekomgesellschaft Telia hat diese Woche gegen 3 Mrd. $ in die Hand genommen, um in Norwegen, Schweden und Finnland Zukäufe im Bereich elektronischer Medien zu tätigen. Man folgt damit einem grösseren Trend zum kombinierten Angebot von Übertragung und Inhalten unter einem Dach.
Die Rheintaler Industriegruppe SFS kann die höheren Rohwarenpreise auf die Kunden übertragen. Das traditionell stärkere zweite Semester soll die angepeilte Margenverbesserung ermöglichen.
Die Kundenberaterin in einer Bank glaubte schon, der Arbeitstag könne nicht mehr schlimmer werden. Doch sie sollte sich irren.
Raiffeisen steckt in starken Turbulenzen. Mitten in der Aufarbeitung der Vincenz-Affäre tritt auch Konzernchef Patrik Gisel zurück. Worum geht es konkret und wie geht es bei der Bankengruppe weiter? Ein Überblick.
Die Strafzölle, die US-Präsident Trump gegen die wichtigsten Handelspartner verhängt, können einen Konflikt mit unabsehbaren Folgen auslösen. China und die EU reagieren mit Gegenmassnahmen und auch die Schweiz ist an die WTO gelangt. Droht jetzt ein Handelskrieg?
Die Digitalwährung Bitcoin hat seit dem Jahresanfang die Hälfte ihres Werts verloren. War der frühere Hype nur heisse Luft, eine Spekulationsblase oder gar Manipulation? Die wichtigsten Antworten.
Aufruhr im Autoland Deutschland: Zunächst erschütterte der Dieselskandal um manipulierte VW-Motoren die Öffentlichkeit. Jetzt gerät nach Volkswagen auch die Konzerntochter Audi ins Visier der Ermittler. Wir liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Trotz den guten Semesterzahlen haben sich Anleger von den Titeln der Bank Julius Bär getrennt. Schwächelnde Börsen und das Gespenst eines Handelskrieges verderben die Stimmung.
Glaxo erwägt offenbar, sich aus dem Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten zurückzuziehen. Das erinnert an einen analogen Schritt von Novartis. Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied.
Burberry will nicht nur bestimmen, wer ihre Produkte verkaufen darf, sondern auch zu welchem Preis und in welchem Umfeld. Im Zweifelsfalle verbrennt der Luxusgüterhersteller seine Lagerbestände, um sich die Exklusivität zu bewahren.
Wieder einmal bricht Donald Trump eine Regel: In einem Interview übt er Kritik an den Zinserhöhungen der Notenbank. Die unbedachte Äusserung wird das Fed kaum beeindrucken; vielmehr könnte sie kontraproduktiv wirken.
Beim US-Softwaregiganten zeigt sich, dass seine Erneuerungsbemühungen Früchte tragen: Heute ist Microsoft nach Amazon der zweitgrösste Anbieter im schnell wachsenden Markt des Cloud-Computing.
Die neue Regierung in Italien weckt ungute Erinnerungen an die griechische vor drei Jahren. Und noch immer hat der Euro-Raum keine Vorkehrungen getroffen, um staatliche Insolvenzen geordnet zu ermöglichen. Das muss sich ändern.
Die EU reagiert mit mehreren Massnahmen gegen den Protektionismus aus den Vereinigten Staaten. Ein Schutzzoll für die Stahlbranche ist jedoch kontraproduktiv.
Kaum eine Schweizer Gemeinde ist derart abhängig von einem einzelnen Unternehmen wie das Oberwalliser Städtchen Visp. Die Chemiegruppe Lonza ist der dominierende Arbeitgeber und Steuerzahler.
In diesem Jahrhundert durchlitt Irland bereits eine Immobilienkrise, eine Bankenkrise, eine Schuldenkrise und eine Wirtschaftskrise. Jetzt schiessen die Wohnungspreise wieder in die Höhe, aber nicht wegen Spekulation.
Zur Bewältigung der Finanzkrise haben viele Staaten fast ihr ganzes Pulver verschossen. Um geld- und fiskalpolitisch wieder Spielraum zu gewinnen, drängen sich Reformen auf. Was zu tun wäre, skizziert die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Im japanischen Kurort Hakone bekräftigten Vertreter der elf Staaten des transpazifischen Freihandelspakts (CPTPP), dass sie neue Mitglieder in das Handelsabkommen aufnehmen wollen. Schon im kommenden Jahren sollen Verhandlungen beginnen.
Die Londoner City bereitet sich auf ein No-Deal-Szenario vor. Zu den Schutzmassnahmen gehört unter anderem ein Übergangsregime.
Auch das Treffen der G-20-Finanzminister am Wochenende dürfte bei der Suche nach globalen Steuerregeln für Internetfirmen keinen Durchbruch bringen. Immer mehr Staaten setzen im Alleingang auf spezifische Steuern für Google, Facebook und Co. Die Schweiz geht einen anderen Weg.
Die niedrigen Mieten in Zürcher Genossenschaftswohnungen sorgen regelmässig für politische Streitereien. Grund genug, die Kostenstruktur beim genossenschaftlichen Wohnen unter die Lupe zu nehmen.
Neben Miete und Eigentum gibt es beim Wohnen noch einen dritten Weg: das genossenschaftliche Wohnen. Wie genau funktioniert es? Welche Rechte und Pflichten hat man als Mieter? Und: Ist es tatsächlich besonders günstig? Hier die wichtigsten Antworten.
In der Hoffnung, durch die Ankündigung von Zöllen Konzessionen der Handelspartner zu erzwingen, setzt der amerikanische Präsident Trump seine Drohungen in die Tat um.
Die Wirtschaft Nordkoreas ist 2017 nach südkoreanischen Schätzungen so stark geschrumpft wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Ein wichtiger Grund für den Einbruch sind die Sanktionen gegen das Regime.
Die Mehrheit der russischen Bevölkerung glaubt an Verschwörungstheorien. Donald Trump und Wladimir Putin kommen darin aber höchstens als Statisten vor.
Franz Carl Weber kommt wieder in vornehmlich schweizerischen Besitz. Eine Gruppe um CEO Yves Burger hat das Traditionsgeschäft dem französischen Konzern Ludendo abgekauft und hofft damit, die Selbständigkeit des Unternehmens sichern zu können.
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat auch bei der Bank Rothschild rund um den Korruptionsfall des Staatsfonds in Malaysia schwere Verstösse festgestellt. Sie setzte hier, gleich wie bei der Genfer Privatbank Edmond de Rothschild, einen Aufpasser ein.
Die beiden Schweizer Grossbanken werden in den kommenden Tagen ihr Semesterergebnis präsentieren. Bei den Erträgen fehlt der Wachstumstreiber. Die Manager müssen andere Hebel in Bewegung setzen.
Die Gratis-Geschäftsmodelle, die Facebook und Google zu den wertvollsten börsenkotierten Unternehmen der Welt gemacht haben, offenbaren zunehmend ihre wahren Kosten.
Das Traditionshaus Tiffany & Co. hat jüngst erheblich an Strahlkraft eingebüsst. Unter einer neuen Leitung soll die Marke nun wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen.
Alessandro Bogliolo, der neue Chef von Tiffany, erklärt im Gespräch, wie das Traditionshaus sein verstaubtes Image aufpoliert hat.
Hauptbetroffen vom US-Handelsverbot gegenüber Iran sind vorwiegend europäische Firmen. Die Europäer wollen Trump in die Stirn bieten und die in Iran tätigen Firmen schützen.
Mit einer Reihe von Massnahmen kontert die EU die von US-Präsident Trump angrkündigten Iran-Sanktionen. Europäische Unternehmen sollen weiterhin mit Iran geschäften können. Wunder darf man von der EU-Gegenwehr indessen nicht erwarten.
Die EU-Kommission will am Freitag den Prozess zur Reaktivierung einer Verordnung zur Abwehr amerikanischer Iran-Sanktionen formell lancieren. Ziel ist der Schutz kleinerer und mittlerer Unternehmen in der EU.
Solange Iran sein Atomprogramm eingefroren lässt, wollen die Europäer an der Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen festhalten. Die hierzu diskutierten Massnahmen weisen aber Schwächen auf.
Spätestens ab dem 4. November soll das US-Sanktionenregime gegenüber Iran wieder voll greifen. Betroffen dürften vor allem europäische Firmen sein.
Die Vereinigten Staaten haben wieder Sanktionen gegen Iran eingeführt – gegen den Willen ihrer europäischen Verbündeten. Washington versucht die Strafmassnahmen weltweit durchzusetzen. Der beste Erfüllungsgehilfe dabei ist der Dollar.
In Schweizer Wirtschaftskreisen stellt man sich die bange Frage, ob Geschäfte mit Iran weiterhin vertretbar sind. In den beiden Jahren seit der Aufhebung der Sanktionen ist der erhoffte Boom ausgeblieben.
Der Ärger über die Amerikaner ist gross. Die Aussicht, dass deutsche Firmen auf Sanktionslisten der Amerikaner landen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben, wird von Politik und Wirtschaft als anmassend empfunden.
China ist der weltgrösste Rohölimporteur. Gelingt es dem Reich der Mitte, seine Bezüge künftig mit Yuan zu zahlen, stärkte dies die Landeswährung auf Kosten des Dollars.
Einst schätzten die USA Iran als verlässlichen Bündnispartner. Doch seit 1980 bestehen zwischen den beiden Ländern keine diplomatischen Beziehungen mehr. Was ist passiert?
Fast jede Schweizer Firma muss sich ans neue Datenschutzgesetz der EU halten. Dem Einzelnen verschafft es mehr Transparenz. Machen es die Firmen geschickt, resultiert daraus mehr als nur ein bürokratischer Mehraufwand.
Seit Freitagmorgen gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Obwohl das so überraschend wie Weihnachten daherkommt, haben einige Website-Betreiber ihren Dienst (temporär) dichtmachen müssen.
Adrian Lobsiger ist seit bald zwei Jahren ein pragmatischer eidgenössischer Datenschützer. Dass die Schweiz der EU ab diesem Freitag beim Datenschutz hinterherhinkt, macht ihm Sorge.
Die Facebook-Affäre um Cambridge Analytica und die EU-Datenschutzverordnung haben das Thema Datensicherheit in den Vordergrund gerückt. Doch damit haben sie einen anderen Aspekt verdrängt.
Lange haben die Amerikaner einen laschen Umgang mit ihren Daten hingenommen. Fälle wie Cambridge Analytica haben das Thema Datenschutz jedoch in die Öffentlichkeit gebracht. Das neue Datenschutzgesetz der EU allerdings nur bedingt als Vorbild.
Ab 25. Mai gilt die neue Datenschutzverordnung der EU, die den Bürgern die Kontrolle über ihre persönlichen Daten im digitalen Raum zurückgeben will. Was bringt die Reform den Nutzern konkret? Und was bedeutet sie für europäische Unternehmen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.
Wen betrifft die Datenschutz-Grundverordnung, welche Änderungen bringt sie, und warum kommt sie?
Kaum ein Schweizer Unternehmen, das nicht vom neuen Datenschutzgesetz betroffen ist, das nächsten Mai in der EU zur Anwendung kommt. Die Regulierung zwingt Firmen, den Datenschutz ernst zu nehmen.
Im Hinblick auf die bald deutlich schärferen EU-Datenschutzregeln passen Social-Media-Dienste wie Facebook, Whatsapp oder Twitter jetzt ihre Dienste, Hausregeln und Alterslimiten an.
Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad Celsius bleiben. Schweizer Durchschnittstemperaturen haben diese Grenze bereits überschritten, trotzdem steigt der Verbrauch fossiler Energien weiter. Dabei gäbe es eine einfache Antwort.
Wie lässt sich der Absatz von Produkten ankurbeln? Die Marketingspezialisten suchen immer wieder nach Mitteln und Wegen, wie sie die Konsumenten mehr zu Käufen animieren können. Zuweilen erscheinen ihre Methoden unheimlich. Dabei sind die einfachsten Rezepte die wirksamsten.
Ein Luzerner macht Karriere beim «Internetkonzern des 19. Jahrhunderts».
Amy Goldstein erzählt in «Janesville» die Geschichte von den Menschen in der Kleinstadt Janesville im Gliedstaat Wisconsin und wie sie damit umgehen, dass die Autofabrik in ihrem Ort die Tore schliesst.
Bei Kirchenvätern hat das Finanzsystem keinen guten Ruf. Machen Christen, die ein sittliches Leben führen wollen, daher besser einen Bogen um die Welt der Geldwirtschaft?
Braucht ein Finanzsystem in einer digitalen Welt überhaupt noch Banken? Oder wäre dieses System nicht stabiler ohne traditionelle Geldhäuser? Ein neues Buch gibt Auskunft.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und weshalb die wichtigsten Währungen heute nicht mehr ans Gold gebunden sind.
In der Ukraine gehört Gleb Lukyanenko zu den Vorreitern in der Bio-Landwirtschaft. Ein Grossteil seiner Produkte wird in die Schweiz verkauft.
Migros, Coop oder die Mobiliar: Bedeutende Schweizer Konzerne sind als Genossenschaften organisiert. Kaum ein Firmengründer entscheidet sich heute aber noch für diese Gesellschaftsform. Warum ist das so?
Die europäische Wirtschaftswelt wird spätestens 1997 auf Sergio Marchionne aufmerksam, als der Italokanadier die Geschäfte der Alusuisse-Lonza-Gruppe übernimmt.
Bei der Farnborough International Air Show, einer der wichtigsten Messen der Luft- und Raumfahrt, geht es um Milliardenaufträge. Vor allem zwischen Boeing und Airbus gibt es jeweils ein Rennen um die meisten Aufträge.
Die einen befürworten Wohnbaugenossenschaften als Bollwerke gegen Immobilienspekulation, die anderen sehen darin eine fragwürdige Bevorteilung einer kleinen Gruppe durch die öffentliche Hand. Doch welche Gebäude gehören in Zürich überhaupt Genossenschaften?
Rechnet man die gesamten Schulden eines Landes zusammen, also neben denjenigen des Staates auch die der Firmen, Haushalte und des Finanzsektors, ergibt sich eine eher unerwartete Rangliste – in der auch die Schweiz auftaucht.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Der Streit um Handelszölle verdeckte den Blick auf Chinas Wirtschaftsprobleme.
Der jüngste Schwächeanfall der chinesischen Währung scheint zu überraschen und sorgt für eine gewisse Unruhe. Allerdings scheint er gerechtfertigt zu sein.
Nicht das Gepolter des US-Präsidenten zu Zinsen, Währung und Handel macht den Börsen zu schaffen, sondern das Ende der geglätteten Wirtschaftszyklen sorgt für Unruhe.


























