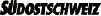
Die USA gehen erneut mit Strafzöllen gegen aus ihrer Sicht zu billige Einfuhren aus China vor. Handelsminister Wilbur Ross kündigte am Mittwoch an, dass gusseiserne Erdrohre aus China mit Strafzöllen von bis zu 109 Prozent belegt würden.
Das Ausfüllen der Steuererklärung – für viele ein lästiges Thema. Beim Einreichen in elektronischer Form passieren viele Fehler. Um diese zu minimieren, publizierte der Kanton Graubünden ein kurzes Erklärvideo. Darin werden die wichtigen Grundlagen erklärt.
Schon vor Donald Trumps Amtsantritt hatten Forscher Sorgen. Der US-Präsident galt als jemand, der Wissenschaft bestenfalls ignoriert. Ein Jahr danach sehen sie sich bestätigt und wollen weiter protestieren - auch an der anstehenden Wissenschaftskonferenz in Austin.
Wer seine Mahlzeiten hastig hinunterschlingt, entwickelt eher krankhaftes Übergewicht. Diesen Zusammenhang bestätigen japanische Forscher in einer Auswertung der Daten von rund 60'000 Menschen.
Das Pharma-Unternehmen Ferring setzt in der Waadt weiterhin auf Wachstum und baut in Saint-Prex VD ein neues Biotech-Zentrum. Für das Zentrum sollen 50 Stellen geschaffen werden.
Hunde revanchieren sich bei ihren Artgenossen für eine Gefälligkeit, auch wenn dies nur über eine andere gute Handlung möglich ist, fand der österreichische Verhaltensbiologe Michael Taborsky heraus.
Ausdruck der Liebe zum Valentinstag ist meist ein Strauss roter Rosen.
Die Regionalbankengruppe Valiant hat im Geschäftsjahr 2017 den Konzerngewinn leicht gesteigert. Der Reingewinn legte im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 119,2 Millionen Franken zu.
Der Finanzdienstleister Leonteq hat eine neue Führungsspitze. Der bisherige Vizepräsident des Unternehmens Lukas Ruflin ist auf Anfang Mai zum neuen Chef ernannt worden.
Die Credit Suisse hat 2017 einen Verlust von 983 Millionen Franken eingefahren. Dafür verantwortlich ist eine Wertberichtigung auf US-Steuergutschriften. Bereinigt um Sonderfaktoren meldet die Grossbank eine Gewinnsteigerung gegenüber dem Vorjahr.
Der Spezialchemiekonzern Clariant hat im vergangenen Jahr mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 6,38 Milliarden Franken. Der Reingewinn verbesserte sich um 15 Prozent auf 302 Millionen Franken.
Die Credit Suisse hat 2017 einen Verlust von 983 Millionen Franken eingefahren. Dafür verantwortlich ist eine Wertberichtigung auf US-Steuergutschriften. Bereinigt um Sonderfaktoren vermeldet die Grossbank am Mittwoch eine Gewinnsteigerung gegenüber dem Vorjahr.
Der angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba peilt erstmals seit vier Jahren wieder einen milliardenschweren Gewinn an. Im Geschäftsjahr bis Ende März werde voraussichtlich ein Nettoergebnis von umgerechnet rund 3,9 Milliarden Euro erzielt.
Bei der Raiffeisenbank Glarnerland freuen sich Geschäftsleitung und Verwaltungsrat über den positiven Abschluss des Geschäftsjahres 2017 – so sehr, dass sie ihre Genossenschafter erneut in den Zirkus einladen.
Die Chicagoer Börse CBOE Global Markets hat laut Reuters die Aufsichtsbehörde FINRA gebeten, Manipulationsvorwürfe im Zusammenhang mit einem wichtigen Finanzprodukt zu prüfen. Im Zentrum steht der Volatilitätsindex («Angstbarometer»), der Marktschwankungen abbildet.
Der Fahrdienstvermittler Uber hat im von Skandalen, Führungschaos und Rechtskonflikten geprägten 2017 einen hohen Verlust erlitten. Das Minus betrug 4,5 Milliarden Dollar, der Umsatz lag bei 7,4 Milliarden. Die Verluste wurden im letzten Quartal reduziert.
Japans Wirtschaft ist das achte Quartal in Folge gewachsen. Das zeigen vorläufige Regierungsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Demnach legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum von Oktober bis Dezember aufs Jahr hochgerechnet um 0,5 Prozent zu.
Der Grosse Rat liess sich gestern an der Pädagogischen Hochschule in Chur vor Ort über die Schule der Zukunft informieren. Gezeigt hat sich dabei vor allem eins: Die Wissenschaft und die Schulen gehen von ganz anderen Dingen aus als die Bündner Wirtschaft.
In den USA bahnt sich eine milliardenschwere Fusion in der Versicherungsbranche an. Kemper will den Konkurrenten Infinity Property and Casualty übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Der Kaufpreis über 1,3 Milliarden Dollar solle in bar und Aktien entrichtet werden.
Der deutsche Immobilienentwickler Instone hat seine Aktien beim Börsengang in Frankfurt am unteren Ende der Preisspanne untergebracht. 19,9 Millionen Anteilsscheine des Essener Unternehmens wurden zu je 21,50 Euro platziert, teilte Instone am Dienstagabend mit.
Am Grossteleskop der Europäischen Südsternwarte (Eso) in Chile ist erstmals das Licht der vier Hauptteleskope gebündelt worden. Ein an der Universität Genf entwickelter Spektrograph hat dies ermöglicht.
Die Schweiz hat im vergangenen Jahren wieder mehr Waren nach China und Hongkong geliefert. Nach der Stagnation der Ausfuhren im Vorjahr hat insbesondere der Export von Uhren wieder deutlich angezogen.
Die Bank Vontobel hat im letzten Jahr einen deutlichen Neugeldzufluss verbucht. Der Start ins 2018 war laut Vontobel-Chef Zeno Staub trotz starken Börsenschwankungen in den letzten Wochen sehr positiv.
Der Schweizer Fleischverarbeiter Bell ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Den Jahresgewinn steigerte Bell um 5,9 Prozent auf 106,5 Millionen Franken. Der Umsatz stieg ebenfalls um 5,9 Prozent und lag bei 3,6 Milliarden Franken.
Hohe Schulden und sinkende Nachfrage nach Pistolen und Gewehren zwingen einen der ältesten US-Waffenhersteller in die Insolvenz. Die Remington Outdoor Company kündigte am Montag einen Antrag auf Gläubigerschutz an.
Der US-Autohersteller GM schliesst im Zuge seines Umstrukturierungsprogramms eines seiner vier Werke in Südkorea. Über die Zukunft der anderen Betriebe werde innerhalb der nächsten Wochen entschieden, sagte GM-Präsident Dan Ammann der Nachrichtenagentur Reuters.
Ende Dezember brannte die Landi in Thusis vollständig ab. Ein junger Mann legte damals ein Feuer. Vor kurzem begannen nun Bagger mit dem Abbruch der Trümmer der zerstörten Gebäude. In den nächsten Wochen öffnen zwei Provisorien ihre Türen. Und noch vor Weihnachten soll alles wieder aufgebaut sein.
Jahrelang waren im Linthgebiet Preisabsprachen im Strassen- und Tiefbau gang und gäbe: 2016 büsste die Weko acht Baufirmen mit total fünf Millionen Franken. Bis heute wehren sich einige Firmen gegen die Busse sowie die Publikation des Weko-Berichts. Somit bleibt vorerst weiterhin unklar, bei welchen Projekten geschummelt wurde.
Der Fernbus-Betreiber Flixbus will weiter expandieren und laut Angaben eines Gründers dazu auch mit Airlines zusammenarbeiten. Möglich wäre demnach ein gemeinsames Angebot, so dass der Kunde nur noch ein Ticket brauche, von daheim über den Flughafen bis ans Endziel.
Einer Patientin im US-Staat Oregon sind Würmer aus dem linken Auge entfernt worden. Der Parasit sei durch Fliegen übertragen worden und trete sonst bei Rindern im Norden der Vereinigten Staaten und im Süden von Kanada auf, teilten Wissenschaftler am Montag mit.

Mittlerweile sind hierzulande über fünf Millionen Menschen in den Arbeitsmarkt integriert. Vor allem die Zahl der ausländischen Erwerbstätigen ist im vergangenen Jahr gestiegen.
Unter Präsidentin Tsai Ing-wen sucht Taiwan eine stärkere Unabhängigkeit von China. Angesichts der engen wirtschaftlichen Verflechtungen ist das schwierig.
Trotz starkem Franken hat das Unternehmen auch im Detailhandel nach einem schwachen Vorjahr wieder ein Plus erzielt. Der Betriebsgewinn der Gruppe stieg deutlich an.
Die geplante Reform der Ergänzungsleistungen dürfte für einige Pensionskassen erhebliche negative Folgen haben.
Der Staatskonzern Rostec hat seinen Anteil am Waffenhersteller Kalaschnikow auf gut ein Viertel reduziert. Der Produzent des gleichnamigen Gewehrs betreibt neuerdings auch Souvenirläden.
Der Nahrungsmittelkonzern hat im vierten Quartal deutlich an Dynamik eingebüsst. Derweil hat der Verwaltungsrat entschieden, die Bande zur Besitzerfamilie von L'Oréal etwas zu lockern.
Der Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele plädiert für Gelassenheit und Neugier im Umgang mit den Bitcoin-Technologien. Im Hinblick auf das Euro-Clearing ist er skeptisch, dass dieses in London bleiben kann.
Der grösste Kabelnetzbetreiber der Schweiz blickt auf ein durchzogenes Jahr zurück. Von den teuer erkauften Rechten für Schweizer Eishockey gehen bis jetzt kaum Impulse aus.
Der Marktführer bei den Zahnimplantaten wagt es, die bisher bewusst separat gehaltenen Premium- und Billig-Marken organisatorisch unter ein Dach zu stellen. Die geografische Expansion geht weiter.
Die Frage ist nicht erst seit den Post-Turbulenzen berechtigt. Doch der Bund unternimmt einiges, um nicht zu viel zu bezahlen.
Auch wenn die Zinskurve sich in den letzten Wochen wieder steiler zeigte, im Verhältnis ist sie über Monate hinwegdeutlich flacher geworden. Ist das nun das Ende des Konjunkturzyklus und droht eine Rezession?
Der Bankmitarbeiter war positiv überrascht über seinen diesjährigen Bonus. Doch seine Freude währte nur kurz.
Die Bank hat im vergangenen Jahr besser verdient und schüttet eine deutlich höhere Dividende aus. Diese Grosszügigkeit steht auch im Zusammenhang mit dem 150-Jahre-Jubiläum des Instituts.
Der Werkzeugmaschinenhersteller Tornos aus Moutier hat seit 2012 kumuliert Verluste von über 50 Mio. Fr. eingefahren. Angesichts dieser dürftigen Leistung ist der jüngst erwirtschaftete Gewinn nur ein schwacher Trost.
Die in Rolle ansässige Petrochemie-Holding Ineos lässt den geplanten Bau eines Geländewagens nach dem Vorbild des legendären Land Rover Defender von MBtech realisieren.
Das ist bitter für den soeben abgetretenen Präsidenten Südafrikas: Kaum ist er weg, stürzen sich Anleger auf Aktien und Anleihen sowie die Währung des Landes.
Das defizitäre Unternehmenssegment Elcom/EMS hat auch 2017 in den roten Zahlen abgeschlossen. Gruppenweit lagen Betriebs- und Nettogewinn nur knapp unter dem Vorjahr.
Die Digitalwährung Bitcoin wird derzeit heftig durchgeschüttelt – und zeigt alle Anzeichen einer Spekulationsblase, der Luft entweicht. Was steckt dahinter, und wie funktionieren Bitcoins überhaupt? Die wichtigsten Antworten.
UPC und Swisscom lieferten sich einen erbitterten Streit um Schweizer Sportrechte. Nun mehren sich die Zeichen, dass die beiden Telekomfirmen dabei zu tief in die Tasche gegriffen haben.
Sich für einen Fehler spontan zu entschuldigen, scheinen die Schweizer im Geschäftsalltag verlernt zu haben. Dabei würde ein «Äxgüsi» oder «Pardon» viele enttäuschte Kunden versöhnlich stimmen.
Japans Wirtschaft läuft zurzeit rund, es herrscht Vollbeschäftigung. Der Rückgang der Wohnbevölkerung schafft in der rasch alternden Nation jedoch grösser werdende Probleme.
Frauen verdienen in der Schweiz im Durchschnitt deutlich weniger als Männer. Eine Ständeratskommission will das mit staatlichen Lohnkontrollen ändern. Wieso dies wieder einmal eine unsinnige Idee ist.
Mit der Abschaffung des «Pflegeregresses» wird ein Wahlgeschenk in Österreich weit teurer als gedacht. Die Politiker hatten nicht berücksichtigt, dass Menschen auf veränderte Anreize reagieren.
Ende des laufenden Jahres wird sich zeigen, ob die 2015 vom CS-Konzernchef Tidjane Thiam angekündigten Gewinnziele erreicht werden.
Chefs von SMI-Firmen sind in den sozialen Netzwerken aktiver als ihre Kollegen in Deutschland und Österreich. Besonders präsent sind UBS-Chef Sergio Ermotti und Adecco-CEO Alain Dehaze.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Arbeitgeber und Gewerkschafter der Maschinenindustrie vereinigen sich gegen die Kündigungsinitiative der SVP.
Auf beiden Seiten des Atlantiks erfreut sich die Wirtschaft eines soliden Aufschwungs. Es deutet vieles darauf hin, dass dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben wird.
Systemrelevante Banken wie die UBS oder die Credit Suisse sollen beim Aufbau von Kapital nicht zusätzlich besteuert werden. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden.
An den Börsen wird die Nervosität neu geschürt. Die Inflation in den USA zieht um 2,1 Prozent an. Experten hatten nur mit 1,9 Prozent gerechnet. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen. Die Börsen reagierten mit Kursverlusten – zumindest kurzfristig.
Kryptowährungen wecken im Königreich wie auch in China, Taiwan und Malaysia Bedenken.
Beobachter fürchten, die Grossaktionäre wollen die Zahlungsverkehrs-Division der SIX möglichst teuer verkaufen, statt den Finanzplatz strategisch zu stärken.
Das Wirtschaftswachstum in Japan hat sich am Jahresende 2017 deutlich verlangsamt. Vieles spricht aber dafür, dass die Konjunktur weiter robust bleibt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörte Argentinien zu den reichsten Ländern der Welt. Heute ist es ein Schwellenland. Tragen die marktwirtschaftlichen Reformen von Präsident Mauricio Macri Früchte, könnte eine Renaissance gelingen.
Mit dem Einzug des neuen Ankeraktionärs von Clariant, dem saudischen Unternehmen Sabic, haben auch die Turbulenzen im Baselbieter Chemiekonzern ein Ende. An einer Vollübernahme seien die Saudiaraber nicht interessiert, heisst es bei Clariant.
Trotz Wertberichtigungen auf latenten Steuerguthaben in den USA nimmt die Wende zum Besseren immer klarere Konturen an.
Die Grossbank hat ihre Ausschüttungspolitik verändert. Gleichzeitig reduziert sie die Dividende.
Lukas Ruflin wird CEO beim Derivatespezialisten. Er hat die Firma 2007 mitgegründet, unter anderem mit Jan Schoch, den er nun an der Unternehmensspitze beerbt.
Die zweitgrösste staatliche Bank des Schwellenlandes hat betrügerische Transaktionen über 1,77 Mrd. $ entdeckt. Indiens Geldhäuser in öffentlicher Hand leiden unter riesigen faulen Krediten und zunehmendem Reputationsverlust.
Die Zürcher Privatbank Vontobel hat im vergangenen Jahr solide Erträge erzielt.
Marktführender Schweizer Fleischverarbeiter: Das war der bisher übliche Kurzbeschrieb der Bell AG. Die Umschreibung ist jedoch nicht mehr zeitgemäss.
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Seit der Bankenkrise 2007/08 wird an den Spielregeln des Finanzmarktes geschraubt. Das Dickicht an Regeln wird immer undurchdringlicher. Es ist höchste Zeit, die Regulierung endlich klar auszurichten.
Banker wie Axel Weber und Aufseher wie Elke König warnen vor neuer Regulierungs-Kleinstaaterei. Bail-in-Kapital bei Bankenpleiten ist oft noch in den falschen Händen. Die Folgen der Krise dauern an.
Rückblick auf die Vorboten der Finanzkrise vor zehn Jahren – die Subprime-Kredite sind zwar gezähmt, doch drohen andere Gefahren.
Es hat lang gedauert, bis sich die Finanzwirtschaft einigermassen aus dem Loch herausgearbeitet hat, in das sie 2007 gefallen war. Es gibt indes Kollateralschäden, die weiter Anlass zur Sorge geben.
Braucht ein Finanzsystem in einer digitalen Welt überhaupt noch Banken? Oder wäre dieses System nicht stabiler ohne traditionelle Geldhäuser? Ein neues Buch gibt Auskunft.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zieht sich zwar den Mantel der Wissenschaft über. Sein Buch zur Europäischen Währungsunion verkommt dennoch zum Pamphlet.
Das Verhältnis zwischen den Baslern und ihrer Industrie war und ist nicht immer ein einfaches. Ein neues Buch zeichnet die Verflechtung von Stadt und Chemie nach.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Guy de Picciotto, Chef der Privatbank UBP, glaubt, dass die Finanzbranche ein neues Kapitel aufschlagen könne. Nach einer Phase der Transformation biete sich die Chance, alte Stärken auszuspielen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft mit ausländischen Vermögen ist keine Goldgrube mehr. Dennoch setzt der Schweizer Finanzplatz auf dieses Geschäft. Vier Experten erklären, wo Banken noch wachsen können und welches die grössten Herausforderungen sind.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Nur jene Banken werden gestärkt daraus hervorgehen, die Althergebrachtes hinterfragen, Innovatives wagen.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigennützig ist. Doch uns sind auch andere Motivationen zu eigen.
Zahlreiche Grosskonzerne und mittelgrosse Firmen schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Vor zehn Jahren als Methode zur Stressbewältigung eingeführt, soll sie heute noch mehr können.
Oft ist es nicht die Arbeit, die Menschen ausbrennen lässt, sondern die Vernachlässigung ihrer Ressourcen. Dem Wichtigsten schenken sie meistens am wenigsten Beachtung: ihrem Bedürfnis nach Bindung.
Die Neurowissenschaften haben bewiesen: Meditation ändert nicht nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch seine Morphologie.
Bosch, Beiersdorf und Axpo flankieren mit Achtsamkeitstraining der Führungskräfte ihre Transformation in agile Unternehmen. Nach anfänglicher Skepsis zieht die Mehrheit der Geschulten positive Bilanz.
Eine Unternehmenskultur ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, das man sich erst leisten sollte, wenn der Laden gut läuft. Achtsamkeit kann vor Fehlentwicklungen schützen.
Neuseeland hat sich für Superjachten zu einer beliebten Zwischenstation auf Weltumrundungen entwickelt. Die lokale Industrie ist dafür vorbereitet.
«Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika alleine», sagte US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum in Davos. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden.
Infizieren, ausspionieren und erpressen, Cyberkriminalität hat viele Facetten. In den letzten Jahren haben dabei die Risiken für Schweizer Unternehmen massiv zugenommen.
Bahnen, Metros, Strassen und Flughäfen in den USA sind seit Jahren in einem desolaten Zustand. Präsident Trump versprach 1 Bio. Dollar, um die Infrastruktur zu verbessern, nun spricht er von 200 Mrd. Inzwischen häufen sich Pannen und Unfälle.
Der hochprozentige Schnaps Baijiu, auch «weisser Alkohol» genannt, vernebelt vielen Chinesen die Sinne. Die steigende Nachfrage und der damit verbundene wirtschaftliche Erfolg der grössten Brennerei wecken bei den Machthabern Skepsis.
Ein Kurssturz an den US-Börsen zieht die Aktienmärkte rund um den Globus in die Tiefe. Auch SMI und DAX starten mit deutlichen Verlusten in den Handel.
Firmen wie die Swiss Re oder die Credit Suisse führen eigene Seminarzentren, die als Orte der Weiterbildung und Erholung dienen. Die Zentren sind aber auch dazu da, Mitarbeitern und Kunden die Unternehmenskultur näherzubringen.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Die Anleihen der europäischen Peripherieländer präsentieren sich sehr robust. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Spekulationen mit dubiosen Kryptowährungen sind scheinbar äusserst lukrativ. Mit Verkaufsoptionen liessen sich jüngst ebenfalls hohe Kursgewinne erzielen. Dieser Markt ist reeller als der Wilde Westen in Kryptoland.
Nach dem Kurssturz an der Wall Street am Montag haben Credit Suisse und Nomura zwei komplizierte Finanzprodukte liquidiert. Dies ruft böse Erinnerungen an den Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 wach – auch wenn die unmittelbaren Folgen nicht dieselben sind.


























