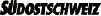
Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat die jüngsten Kursstürze an den Börsen als «notwendige Korrekturen» auf den Finanzmärkten eingestuft.
Der vor gut drei Wochen angekündigte Megadeal für den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus ist besiegelt: Die arabische Fluggesellschaft Emirates hat am Sonntag in Abu Dhabi die feste Bestellung von 20 Exemplaren des weltgrössten Passagierjets A380 unterzeichnet.
Aufgewachsen ist Marina Glaus in Benken. Heute unterrichtet sie im Silicon Valley. Dort fordern sie die anspruchs- vollen Eltern ihrer Schüler.
Tina Heide hat im Januar am WEF als Direktorin des «Steigenberger Grandhotels Belvédère» hochrangige Persönlichkeiten begrüsst. Beim «Zmorga» verrät sie, wovon sie als Teenager träumte und welche Beziehung sie zu Tango und Cash hat.
Der grösste britische Einzelhändler Tesco will einem Zeitungsbericht zufolge den Vormarsch der deutschen Konkurrenten Aldi und Lidl mit einer eigenen Discountmarkt-Kette stoppen. Das Angebot in den Discount-Läden solle nicht so gross wie in den Tesco-Geschäften sein.
Der frühere US-Astronaut William «Bill» Anders hält die Mars-Pläne des Tech-Unternehmers Elon Musk für «lächerlich». «Ein Flug zum Mars ist schwieriger, als Musk oder die Nasa zugeben», sagte Anders der Zeitung «Welt am Sonntag».
Die Talfahrt an den internationalen Börsen und eine verstärkte Nachfrage nach US-Dollar setzen den argentinischen Peso unter Druck. Am Freitag wertete die Währung gegenüber dem Dollar weiter ab und notierte auf dem historischen Tiefstand von 20,35 Pesos zum Dollar.
Das Busunternehmen Domo Reisen will ein nationales Fernbusnetz aufbauen. Und kämpft schon eine ganze Weile für eine Haltestelle in Ziegelbrücke. Doch Auflagen von Kanton und Gemeinden machen die Suche schwierig.
Ein erst vor rund einer Woche entdeckter Asteroid ist relativ nah an der Erde vorbeigeflogen. Eine Gefahr für die Erde stellte «2018 CB» nicht dar. Die Entfernung entsprach aber weniger als einem Fünftel der Strecke zwischen Erde und Mond.
Clariant-Chef Hariolf Kottmann sieht die Eigenständigkeit des Unternehmens nach dem Eintritt des saudi-arabischen Investors Sabic nicht gefährdet.
In diesen Tagen beginnen die Arbeiten an der neuen Rad- und Fussgängerbrücke in Landquart. Die Brücke überführt die Verbindungsstrasse zwischen der Ausfahrt Landquart A13 Nordspur und der A28 beim Kreisel Ost. Die Überführung ersetzt das aktuelle Provisorium und vervollständigt die Langsamverkehrsverbindung zwischen Landquart und Bad Ragaz.
Die Integra Biosciences AG investiert in den nächsten Jahren 20 Millionen Franken und vergrössert ihren Hauptsitz in Zizers um 150 Prozent.
Die von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullogeführte Ems-Chemie-Gruppe hat die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Vorjahre auch 2017 fortgesetzt. Bei den Einnahmen übertraf die Gruppe erstmals die Marke von 2 Milliarden Franken. Mit Blick auf die im Jahr 2017 gestiegenen Rohstoffpreise hält Martullofest: Bisher ist es mehr oder weniger gelungen, die höheren Rohstoffpreise an die Kunden weiterzugeben. Und die Rohstoffpreise würden weiter steigen. Wie die Ems-Gruppe einer Verknappung der Rohstoffe begegnet, erklärt die Chefin im Video-Interview.
Die Fluggesellschaft Swiss hat im Januar etwas weniger Passagiere befördert als im Vorjahresmonat. 1,18 Millionen Menschen flogen im ersten Monat des Jahres mit der Fluggesellschaft, das sind 0,9 Prozent weniger als im Januar 2017.
Die Schweizer Traditionsmarke Bally hat mal wieder einen neuen Besitzer - das Unternehmen geht nach China zu Shandong Ruyi.
L«Oréal ist an einem Rückkauf der Nestlé-Beteiligung von 23 Prozent am französischen Kosmetikkonzern interessiert. "Wenn Nestlé eines Tages verkaufen will, sind wir bereit", sagte L»Oréal-Chef Jean-Paul Agon am Freitag. Sein Unternehmen verfüge über genügend Mittel.
Mit dem Verkauf des Ferienvereins wechseln auch die Hotels «Schweizerhof» in Sils-Maria und «Altein» in Arosa den Besitzer. Dieser sichert zu, die Hotels weiterzuführen, zu erneuern und die Arbeitsplätze zu erhalten.
Der Güterverkehr hat sich im vierten Quartal 2017 vom Unterbruch der Rheintallinie im Spätsommer 2017 bei Rastatt D erholt. Die Verkehrsleistung stieg um 3,7 Prozent auf 3,11 Milliarden Nettotonnenkilometer. Grund für die Zunahme dürfte ein Nachholeffekt sein.
Die Arbeitslosenquote ist im Januar im Vergleich zum Vormonat gleich geblieben: Sie verharrt bei 3,3 Prozent. Allerdings stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht an, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte.
Die Arbeitslosenquote ist im Januar im Vergleich zum Vormonat gleich geblieben: Sie verharrt bei 3,3 Prozent. Allerdings stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht an, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte.
Dank guter Marktpositionierung der Bank steigt das Geschäftsergebnis 2017 auf 197.9 Millionen Franken. Auch der Kanton Graubünden und der Beitragsfonds für nichtkommerzielle Projekte profitieren davon.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf 782 Millionen Franken steigern können. Dazu beigetragen hat vor allem das gutes Abschneiden im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft.
Die von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo geführte Ems-Chemie-Gruppe hat die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Vorjahre auch 2017 fortgesetzt. Bei den Einnahmen übertraf die Gruppe sogar einen besonderen Zielwert.
Die schweren Waldbrände in Kalifornien und die Auswirkungen der US-Steuerreform haben den Versicherungsriesen AIG im vierten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust liege bei 6,7 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Nico Schottelius will für 250 000 Franken sein Datencenter in Linthal ausbauen. Dank einer Crowdfunding-Kampagne, die morgen endet, stehen die Chancen gut.
An der 55-Stunden-Woche in der Landwirtschaft wird sich so schnell nichts ändern.
Die Wärme der KVA Linth heizt jetzt auch im Gartencenter Grünenfelder. Weitere Kunden könnten schon bald folgen.
Nach erneut heftigen Kursverlusten an der Wall Street sind auch die Märkte in Asien am Freitag deutlicher schwächer gestartet. Der japanische Index Nikkei 225 lag bis zum Mittag mehr als 3,2 Prozent im Minus bei 21'185 Punkten.
Die US-Regierung bereitet sich auf eine weitere Haushaltssperre vor. Das Weisse Haus habe die US-Bundesbehörden angewiesen, sich auf einen erneuten Shutdown einzustellen.
Das Verlagsgeschäft von Medienmogul Rupert Murdoch mit Titeln wie dem Finanzblatt «Wall Street Journal» oder der britischen «Times» hat zum Jahresende 2017 leicht zugelegt.

Eine Erneuerung stände Amerikas Strassen, Brücken und Flughäfen sicher nicht schlecht an. Die Vorschläge des Weissen Hauses überzeugen aber nicht.
Eine Bestechungsaffäre, in dem der Pharmakonzern Novartis eine Hauptrolle spielen soll, zeigt Missstände im griechischen Gesundheitswesen auf. Die Reformkur, welche die internationalen Geldgeber verordnet haben, wirkt erst ansatzweise.
Präsident Trump will sein Wahlkampfversprechen doch noch wahr machen und präsentiert am Montag seine «Infrastrukturprinzipien». Die Frage ist nur, woher das Geld dafür kommen soll.
In allen wichtigen Produktionsländern Europas war die Weinlese im vergangenen Jahr rückläufig. Für Konsumenten stellt sich die Frage, ob sie für das Getränk nun mehr bezahlen müssen.
Nach China geht auch Thailand scharf gegen Digitalwährungen vor. Künftig ist es Banken und sonstigen Finanzinstitutionen verboten, Geschäfte mit Digitalwährungen wie Bitcoin zu machen.
Die australische Investmentbank Macquarie hat zusammen mit drei dänischen Pensionsfonds ein Kaufangebot für TDC vorgelegt, die ursprünglich selber durch eine Akquisition wachsen wollte.
Die amerikanische Finanzierung der Internationalen Raumstation ISS läuft 2024 aus. Auch Russland hat seinen Rückzug bereits angekündigt. Während Unternehmen dies als Chance sehen, halten andere eine kommerzielle Nutzung für Unsinn.
Die Schweizer Regierung will Schadenersatzklagen für grosse Gruppen von Geschädigten erleichtern. Der Vorschlag wird starke Kontroversen auslösen. Widerstand ist vor allem von der Wirtschaft zu erwarten.
Der Medtech-Branche in Europa geht es zurzeit prächtig. Nur der Übergang zur strikteren EU-Regulierung macht ihr Sorge. Bei der Markteinführung neuer Produkte sind Verzögerungen absehbar, weil es an Zertifizierungskapazitäten mangelt.
Das Freiburger Technologieunternehmen Comet hat 2017 trotz einem Glanzergebnis nicht ganz so gut abgeschnitten, wie Finanzanalytiker sich dies erhofft hatten. Hans Hess, der auch dem Maschinenindustrie-Branchenverband Swissmem vorsteht, will aus Altersgründen als Verwaltungsratspräsident der Firma 2019 zurücktreten.
Die Investitionen in Insurtech haben im vergangenen Jahr um ungefähr einen Drittel auf 2,3 Mrd. $ zugenommen. Vermehrt werden etablierte Versicherer auf diesem Feld aktiv, aber es gibt auch Neulinge, die das Versicherungsgeschäft aufwirbeln.
Herbert K. Haas verlässt nach 12 Jahren als Konzernleiter das Cockpit der Versicherungsgruppe. Nun wechselt er an die Spitze des Aufsichtsrats – und wird wohl dennoch wieder zum «Pilot in Command».
Am Montag sind die nervösen Börsen in den USA mit einem klaren Plus von über 1% in die neue Handelswoche gestartet. In Europa liegen die Kurse sogar noch stärker im grünen Bereich.
Facebook muss die Voreinstellungen für seine Dienste in Deutschland verändern und darf seine Anwender nicht länger zwingen, sich mit ihrem echten Namen anzumelden. Das folgt aus einem Urteil des Landgerichtes Berlin, das am Montag veröffentlicht wurde.
Ausgerechnet Google: Der US-Konzern, der seine Gewinne hauptsächlich über Werbung generiert, will ebendiese reduzieren. Für seinen Internetbrowser Chrome kündigt Google einen Werbefilter an. Das ruft auch Kritiker auf den Plan.
Angesichts einer boomenden Weltwirtschaft rechnet die Opec im laufenden Jahr mit einer schneller wachsenden Nachfrage nach Rohöl als bisher angenommen.
Ermittlungen bei der BASF: Mitarbeiter sollen den Chemiekonzern zusammen mit externen Dienstleistern um einen Millionenbetrag gebracht haben. Angeblich wurden Rechnungen beglichen, für die es keine Gegenleistung gab.
Die Digitalwährung Bitcoin wird derzeit heftig durchgeschüttelt – und zeigt alle Anzeichen einer Spekulationsblase, der Luft entweicht. Was steckt dahinter, und wie funktionieren Bitcoins überhaupt? Die wichtigsten Antworten.
«Novartis Gate» ist im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre in Griechenland bereits zum stehenden Medienbegriff geworden. Dennoch ist alles andere als klar, ob sich das Unternehmen etwas zuschulden hat kommen lassen.
An den weltweiten Aktienmärkten ist in den zurückliegenden Tagen Börsenvermögen von ein paar Billionen Dollar vernichtet worden. Droht nun ein Überschwappen der Turbulenzen auf die Realwirtschaft?
Der amerikanische Kongress hat unter der Führung der Republikaner einen Budget-Deal geschlossen, der die Schieflage des Haushalts nochmals erheblich verschärft. Das in einer wirtschaftlichen Schönwetterperiode zu tun, ist verantwortungslos.
Die Bank Cler entwickelt ihre Finanz-App Zak weiter. Auf den ersten Blick scheint diese ein Gemischtwarenladen zu sein. Strategisch steckt aber mehr dahinter.
Finnland preist sich als weltweit erstes Land ausserhalb Chinas an, wo man alle Geschäfte über die Bezahl-Plattform Alipay des Internetkonzerns Alibaba erledigen könne. Eine chinesische Reisegruppe machte die Probe aufs Exempel.
An der Börse hat die Spekulation, dass sich die japanische Softbank mit 10 Mrd. $ an Swiss Re beteiligen könnte, ein Kursfeuerwerk entfacht. Was die Japaner in die Waagschale werfen, ist allerdings unklar.
Viele Chemieunternehmen haben sich in den vergangenen Jahren einseitig auf chinesische Zulieferer verlassen. Wegen Umweltschutzmassnahmen sind viele Rohwaren aus China nun deutlich teurer geworden. Abhilfe ist so schnell nicht in Sicht.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Mit einer Flat Tax, einem bedingungslosen Grundeinkommen und höheren Renten werben Italiens Parteien um die Wählergunst. Leisten kann sich das hochverschuldete Land solche Milliardenprojekte derzeit aber nicht.
Auch Zentralbanken kann das Geld ausgehen, und zwar dann, wenn sie ausländische Währungen benötigen. Es gibt jedoch Mittel und Wege, um solche Engpässe zu vermeiden. Das beherzigt auch die Schweizerische Nationalbank.
Der deutsche Arbeitsmarkt ist bereits stark reguliert. Nun setzt die grosse Koalition aber noch eins drauf: Befristete Verträge will sie stark einschränken. Und nach dem Recht auf Teilzeit soll es auch eines auf Rückkehr in Vollzeit geben.
Brüssel drängt Bern auf die Übernahme von Staatshilferegeln – das könnte Folgen zum Beispiel für Kraftwerke und Kantonalbanken haben.
Die Republikaner haben ihre Defizit-Aversion aus der Obama-Zeit abgelegt und geben mit beiden Händen Geld aus. Nun müssen die Mittel den einzelnen Posten zugewiesen werden.
Der selbstverschuldete Konkurs von Carillion empört viele Briten. Er demonstriert die Schwachstellen der Auslagerung öffentlicher Aufgaben. Käme die linke Labourpartei an die Macht, drohte die Gefahr, dass sie das Kind mit dem Bade ausschüttet.
Der Aufwärtstrend am hiesigen Arbeitsmarkt verfestigt sich. Dies bestätigen die neusten Arbeitslosenzahlen. Im Bausektor sind die Perspektiven für die Beschäftigten so gut wie seit fünf Jahren nicht mehr.
Die deutschen Apotheker frohlocken: Eine neue grosse Koalition will den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten verbieten. Dies trifft besonders den Marktführer Doc Morris, eine Tochter der Schweizer Versandapotheke Zur Rose.
Wie motivierend ist die langersehnte Salärerhöhung? Forscher haben den Zusammenhang zwischen Verdienst und Engagement der Mitarbeiter untersucht – und kommen zum Teil zu überraschenden Ergebnissen.
Das Genfer Strafgericht hat einen Vermögensverwalter der Schweizer Grossbank zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Dagegen verzichtete das Gericht auf die Verhängung eines zusätzlichen mehrjährigen Berufsverbotes.
Die Zürcher Kantonalbank hat im vergangenen Jahr besser verdient. Davon profitieren auch Kanton und Gemeinden.
Christian Walti löst Walter Börsch bei der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag als CEO ab.
Die Wohnungen auf dem Zürcher Labitzke-Areal sind erst im April bezugsbereit, aber bereits seit dem Herbst alle vermietet. Die Eigentümerin Mobimo stellt nun einen «Sekundärmarkt» mit den Mietverträgen fest.
Die Schweizer Traditionsmarke Bally wird an ein chinesisches Textilunternehmen verkauft. Der Fall relativiert die Spekulationen, dass die Einkaufstour chinesischer Unternehmen im Ausland wegen der Vorkommnisse rund um die HNA Group abebbt.
Das Chemieunternehmen Ems stellt sich nach einem neuerlichen glänzenden Geschäftsjahr auf eine mögliche Konjunkturabkühlung ein. Der Chefin Magdalena Martullo-Blocher ist die Partystimmung in vielen Wirtschaftssektoren nicht geheuer.
Der Besuch des US-Präsidenten in Davos hat die Schweiz in einen zweiwöchigen Ausnahmezustand versetzt. Wie konnte das geschehen? Das grosse Trump-Theater in vier Akten.
Donald Trump hat seinen Auftritt in Davos gut genutzt, und die ans WEF gereiste Elite zeigte sich ungewöhnlich optimistisch. Doch gerade Europa bleibt akut gefordert und sollte nicht in Überschwang verfallen.
Der Auftritt des amerikanischen Präsidenten am WEF in der Schweiz ist ohne Eklat abgelaufen. Trump machte vor allem Reklame für sein Land und lud internationale Konzerne ein, nun in den USA zu investieren.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fordert einen Beitrag der Bauern bei den Freihandelsgesprächen. In Sachen Verständigung mit der EU solle sich die Schweiz nicht unter Druck setzen lassen, meint er.
US-Präsident Donald Trump hat das diesjährige WEF geprägt wie kein anderer. Mit einer grossen Lobrede auf sich und sein Land sorgte er für das Schlussbouquet. Laut den Behörden soll das WEF künftig nicht noch grösser werden.
US-Präsident Donald Trump hat seine mit Spannung erwartete Rede gehalten. Dabei erfand er das Rad nicht neu, zeigte sich aber beim Thema Freihandel offener als auch schon – und natürlich durfte eine Spitze gegen die «Fake-News» nicht fehlen.
Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat der US-Präsident Donald Trump eine Lobrede auf sich selbst und seine Regierung gehalten. Bei der Handelspolitik hörten sich seine Äusserungen etwas besänftigend an.
Am nächsten Mittwoch macht der Bundesrat seine europapolitische Auslegeordnung. Bundesrat Ueli Maurer erklärt seine Haltung.
Donald Trump hat am WEF in Davos Bundespräsident Alain Berset getroffen und seine Abschlussrede gehalten. Darin verteidigte er seine Politik des «America First» und lobte sein eigenes Wirken sowie die Verdienste seiner Regierung.
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Seit der Bankenkrise 2007/08 wird an den Spielregeln des Finanzmarktes geschraubt. Das Dickicht an Regeln wird immer undurchdringlicher. Es ist höchste Zeit, die Regulierung endlich klar auszurichten.
Banker wie Axel Weber und Aufseher wie Elke König warnen vor neuer Regulierungs-Kleinstaaterei. Bail-in-Kapital bei Bankenpleiten ist oft noch in den falschen Händen. Die Folgen der Krise dauern an.
Rückblick auf die Vorboten der Finanzkrise vor zehn Jahren – die Subprime-Kredite sind zwar gezähmt, doch drohen andere Gefahren.
Es hat lang gedauert, bis sich die Finanzwirtschaft einigermassen aus dem Loch herausgearbeitet hat, in das sie 2007 gefallen war. Es gibt indes Kollateralschäden, die weiter Anlass zur Sorge geben.
Wer sind die Personen, die von Offshore-Geschäften profitieren? In den «Paradise Papers» finden sich Namen von Politikern wie Gerhard Schröder und Juan Manuel Santos bis hin zu Künstlern wie Bono, Shakira und Madonna – eine Übersicht.
Mit den «Paradise Papers» rücken die Steuerpraktiken internationaler Konzerne erneut in den Fokus. Globalen Firmen stehen viel mehr Wege offen als lokalen Konkurrenten, um Steuern zu optimieren.
Die vertraulichen Dokumente haben fragwürdige Investments der beiden königlichen Familienmitglieder aufgedeckt.
Als der Bundesrat 2016 die Kandidatur Monika Ribars zur SBB-Verwaltungsratspräsidentin guthiess, war ihm ihr Mandat in Angola nicht bekannt. Ribar war indes vor Antritt ihres neuen Amtes aus der Firma ausgetreten.
Wie ein Schweiz-Angolaner mit Milliarden jongliert und ein Mittelsmann verdächtig tiefe Bergbaulizenzen aushandelte.
Wie so vieles können auch Offshore-Geschäfte für kriminelle oder fragwürdige Geschäfte missbraucht werden. Sie gehören aber zu einer globalen Wirtschaft. Manchmal sind sie Ausdruck von Missständen, kaum je deren Ursache.
Wer steckt sein Geld in Offshore-Konstrukte? War das legal? Und was steht im jüngsten Datenleck zur Schweiz? Ein Überblick.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zieht sich zwar den Mantel der Wissenschaft über. Sein Buch zur Europäischen Währungsunion verkommt dennoch zum Pamphlet.
Das Verhältnis zwischen den Baslern und ihrer Industrie war und ist nicht immer ein einfaches. Ein neues Buch zeichnet die Verflechtung von Stadt und Chemie nach.
Der Euro–Krise liegen nicht nur divergierende Interessen zugrunde. Zwischen Nord und Süd klafft auch ein ideengeschichtlicher Graben. Ein neues Buch nennt die Gründe dafür.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Guy de Picciotto, Chef der Privatbank UBP, glaubt, dass die Finanzbranche ein neues Kapitel aufschlagen könne. Nach einer Phase der Transformation biete sich die Chance, alte Stärken auszuspielen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft mit ausländischen Vermögen ist keine Goldgrube mehr. Dennoch setzt der Schweizer Finanzplatz auf dieses Geschäft. Vier Experten erklären, wo Banken noch wachsen können und welches die grössten Herausforderungen sind.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Nur jene Banken werden gestärkt daraus hervorgehen, die Althergebrachtes hinterfragen, Innovatives wagen.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigennützig ist. Doch uns sind auch andere Motivationen zu eigen.
Zahlreiche Grosskonzerne und mittelgrosse Firmen schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Vor zehn Jahren als Methode zur Stressbewältigung eingeführt, soll sie heute noch mehr können.
Oft ist es nicht die Arbeit, die Menschen ausbrennen lässt, sondern die Vernachlässigung ihrer Ressourcen. Dem Wichtigsten schenken sie meistens am wenigsten Beachtung: ihrem Bedürfnis nach Bindung.
Die Neurowissenschaften haben bewiesen: Meditation ändert nicht nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch seine Morphologie.
Bosch, Beiersdorf und Axpo flankieren mit Achtsamkeitstraining der Führungskräfte ihre Transformation in agile Unternehmen. Nach anfänglicher Skepsis zieht die Mehrheit der Geschulten positive Bilanz.
Eine Unternehmenskultur ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, das man sich erst leisten sollte, wenn der Laden gut läuft. Achtsamkeit kann vor Fehlentwicklungen schützen.
Neuseeland hat sich für Superjachten zu einer beliebten Zwischenstation auf Weltumrundungen entwickelt. Die lokale Industrie ist dafür vorbereitet.
«Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika alleine», sagte US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum in Davos. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden.
Infizieren, ausspionieren und erpressen, Cyberkriminalität hat viele Facetten. In den letzten Jahren haben dabei die Risiken für Schweizer Unternehmen massiv zugenommen.
Bahnen, Metros, Strassen und Flughäfen in den USA sind seit Jahren in einem desolaten Zustand. Präsident Trump versprach 1 Bio. Dollar, um die Infrastruktur zu verbessern, nun spricht er von 200 Mrd. Inzwischen häufen sich Pannen und Unfälle.
Der hochprozentige Schnaps Baijiu, auch «weisser Alkohol» genannt, vernebelt vielen Chinesen die Sinne. Die steigende Nachfrage und der damit verbundene wirtschaftliche Erfolg der grössten Brennerei wecken bei den Machthabern Skepsis.
Ein Kurssturz an den US-Börsen zieht die Aktienmärkte rund um den Globus in die Tiefe. Auch SMI und DAX starten mit deutlichen Verlusten in den Handel.
Firmen wie die Swiss Re oder die Credit Suisse führen eigene Seminarzentren, die als Orte der Weiterbildung und Erholung dienen. Die Zentren sind aber auch dazu da, Mitarbeitern und Kunden die Unternehmenskultur näherzubringen.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Die Anleihen der europäischen Peripherieländer präsentieren sich sehr robust. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Spekulationen mit dubiosen Kryptowährungen sind scheinbar äusserst lukrativ. Mit Verkaufsoptionen liessen sich jüngst ebenfalls hohe Kursgewinne erzielen. Dieser Markt ist reeller als der Wilde Westen in Kryptoland.
Nach dem Kurssturz an der Wall Street am Montag haben Credit Suisse und Nomura zwei komplizierte Finanzprodukte liquidiert. Dies ruft böse Erinnerungen an den Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 wach – auch wenn die unmittelbaren Folgen nicht dieselben sind.


























