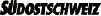
Zwei russische Kosmonauten haben mehr als acht Stunden lang Aussenarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS absolviert. ISS-Kommandant Alexander Missurkin und Raumfahrer Anton Schkaplerow bauten dabei ein neues Schaltmodul an einer Hochleistungsantenne ein.
Das Beizensterben im Glarnerland findet mit der Schliessung des traditionsreichen «City» in Glarus den bisherigen Höhepunkt. «Route 66»-Wirt Marc Brunner sucht nach Erklärungen – und malt nicht schwarz.
15 Bündner Lehrer haben von der Ems-Chemie eine «Explore-It»-Box erhalten. Damit sollen sie ihren Schülern die Welt der Chemie näherbringen.
Die Helifirma Kopter, ehemals Marenco, in Mollis braucht für die Serienproduktion mehr Platz. Dafür muss am Flugplatz Landwirtschaftsland schnell zur Bauzone werden.
Die US-Notenbank Fed hat in einem beispiellosen Schritt für die von Skandalen umwitterte Grossbank Wells Fargo einen Wachstumsstopp angeordnet. Dies teilte die Fed am Freitag mit.
Die scheidende US-Notenbankchefin Janet Yellen wird Expertin bei der Washingtoner Denkfabrik Brookings. «Ich freue mich, dazu zu stossen», erklärte die 71-jährige am Freitag in einer Mitteilung des Instituts.
Die Halbierung der Zahl der Aussteller auf der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld schlägt auf die Einnahmen durch: Die Messebetreiberin MCH Group rechnet mit einem Rückgang um 40 Millionen Franken.
Am Sonntag wird ein Asteroid relativ nah an der Erde vorbeifliegen. Der Himmelskörper namens «2002 AJ129» soll nach Angaben der US-Raumfahrtagentur NASA um 22.30 Uhr Schweizer Zeit in rund 4,2 Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbeirauschen.
Die SDA-Redaktion hat am Freitagnachmittag nach einem knapp viertägigen Streik die Arbeit wieder aufgenommen. Der Streik sei jedoch nicht beendet, sondern nur ausgesetzt, teilte der Branchenverband Impressum mit. Der SDA-Verwaltungsrat willigte in Verhandlungen ein.
Die Gemeinde Domat/Ems und die Rhätische Bahn haben am Donnerstagabend über ihre Pläne informiert. Der Bahnhof soll für etwa 30 Millionen Franken umgebaut werden.
Vor der Küste Libyens sind nach Erkenntnissen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) wohl rund 90 Migranten ertrunken. Am Freitagmorgen sei ein Schleuserboot gekentert, teilte die Organisation mit.
Die Deutsche Bank hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Verlust von 512 Millionen Euro abgeschlossen. Grund dafür seien Belastungen durch die US-Steuerreform, erklärte das Finanzinstitut am Freitag in Frankfurt am Main.
Dem US-Konzern Apple ist es im vergangenen Weihnachtsgeschäft nicht gelungen, einen neuen Absatzrekord beim iPhone aufzustellen. Aber da sich das teurere iPhone X gut verkaufte, gab es Bestwerte bei Umsatz und Gewinn.
Kopter-CEO Andreas Löwenstein erklärt den neuen Firmennamen. Er rechnet mit 800 Arbeitsplätzen in Mollis – falls im Nutzungsplan der Gemeinde noch rechtzeitig Bauland ausgeschieden wird.
Die Regierung gewährt der HTW Chur einen Investitionsbeitrag von maximal 500'000 Franken. Mit diesem Kapital wird der Auf- und Ausbau der Labors für den Studiengang Photonics finanziert.
Die Fleischgenossenschaft Sernftal bekommt für den Bau ihrer neuen Metzgerei keine öffentlichen Gelder. Private Metzgereien hatten sich dagegen gewehrt, dass ihre Konkurrenz mit Subventionsgeldern gefördert werden soll. Die Genossenschafter müssen jetzt bis Ende Mai über eine halbe Million Franken auftreiben.
Gestern haben die Molliser Helibauer ihren neuen Namen «Kopter» gefeiert und den Beginn der Produktion im nächsten Jahr angekündigt. Man strotzt vor Selbstvertrauen und will Weltmarktführer werden.
Wegen Verletzung von Geldwäscherei-Vorschriften hat die Finanzmarktaufsicht (Finma) Sanktionen gegen den Schweizer Ableger der russischen Gazprombank verhängt.
Die Arbeitsgemeinschaft Nickisch Walder aus Flims und Planalytik GmbH aus Flums erhalten den Zuschlag für die Planung der Erneuerung des Tagungszentrums LBBZ Plantahof in Landquart - vorausgesetzt der Grosse Rat gibt grünes Licht.
Dem deutschen Bankenmarkt droht ein Aderlass. Wie aus dem «Bankenreport Deutschland 2030» der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman hervorgeht, wird sich die Zahl der Institute von derzeit rund 1900 in den nächsten Jahren auf nur noch 150 bis 300 Geldhäuser reduzieren.
Mit 81 Jahren ist Schluss: Annamarie Wenger-Maier übergibt das «Pilgerplätzli» in Rapperswil-Jona an Ali Sarikaya.
Die Marenco Swisshelicopter AG (MSH) tritt neu unter dem Namen «Kopter» auf - und auch der Firmenhauptsitz ist nicht mehr am selben Ort.
Facebook verspricht, die beim Online-Netzwerk verbrachte Zeit sinnvoller zu machen und zeigt weniger viral verbreitete Videos. Die Nutzer verbrachten sofort 50 Millionen Stunden pro Tag weniger bei Facebook. Das sei in Ordnung, sagt Gründer und Chef Mark Zuckerberg.
Der polnische Senat hat das umstrittene Gesetz zum Umgang mit dem Holocaust verabschiedet. Das Oberhaus des Parlaments stimmte in der Nacht auf Donnerstag mit 57 Ja- und 23 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den Gesetzentwurf.
Kundegebungen, Demozüge, verschlossene Werkstore: Auch für den zweiten Tag der aktuellen Warnstreik-Welle hat die IG Metall Baden-Württemberg einiges vor.
Neue Medikamente sind bei Roche erst im Kommen, für gestandene Kassenschlager läuft der Patentschutz aus. Der Basler Pharmakonzern bleibt für das laufende Jahr eher vorsichtig. Helfen soll die US-Steuerreform.
In der Industrie wird es zunehmend schwierig, Lehrstellen zu besetzen. Das Ennendaner Blechbearbeitungsunternehmen Hans Eberle AG geht neue Wege.
Das Bergrestaurant «Walau» in Amden hat einen neuen Pächter und ist nach langer Pause wieder geöffnet. Wegen Streitigkeiten zwischen Besitzerin und ehemaligem Pächter war das Lokal lange verwaist. Dieser Streit ist nicht beigelegt. Wie es mit dem «Walau» ab dem Frühling weitergeht, ist vorläufig offen.
GBV-Geschäftsführer Andreas Felix hat sich für eine offensive Kommunikation entschieden, weil der Verdacht, an Preisabsprachen beteiligt gewesen zu sein, den Graubündnerischen Baumeisterverband stark belastet habe.
Der neue Vertrag über die Verteilung der WEF-Sicherheitskosten ist unterzeichnet. Welche Details beinhaltet die Vereinbarung, abgesehen von den Beiträgen? Das Öffentlichkeitsgesetz verschafft Transparenz.

Mark McLaughlin, der Konzernchef von Palo Alto Networks, plädiert bei der Cybersicherheit für eine Vision ähnlich wie damals bei der Mondlandung. Seine Erfahrung als langjähriger Berater amerikanischer Präsidenten verleiht seinen Ideen Gewicht.
Das einstige Star-Institut darf nicht weiter wachsen und muss mehrere Verwaltungsräte ersetzen. Grund sind eine Reihe von missbräuchlichen Geschäftspraktiken und Mängel beim Risikomanagement.
Der Backwarenkonzern hat Schulden, und gleichzeitig verringert sich der Cashflow. Diese Kombination ist fatal und setzt Aryzta unter Zugzwang.
Digitale Plattformen wie Uber oder Upwork sind auf dem Vormarsch. Wird das klassische Angestelltenverhältnis zum Auslaufmodell?
Im kommenden Jahr soll ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan in Kraft treten. Laut dem Bundesrat muss die Schweiz deshalb mit Diskriminierungen rechnen. Betroffen sind vor allem Agrarprodukte.
Neue Technologien wie Kryptowährungen können für manche Nutzer vertrauenswürdiger sein als traditionelle Formen. Gleichzeitig setzen viele Technologiefirmen auf schnelles Wachstum statt dem Aufbau von Vertrauen. Die Publizistin Rachel Botsman geht im Gespräch der Frage nach dem Vertrauen in der digitalen Ökonomie, den Grenzen der Transparenz und der möglichen Regulierung von Technologiegesellschaften nach.
Technologiefirmen wie Amazon, Facebook, Google oder Uber werden verstärkt kritisch gesehen. Es stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig die Konzerne sind, denen man einen grossen Teil seiner Daten anvertraut. Die Publizistin Rachel Botsman gibt Antworten darauf, wie sich der Prozess der Vertrauensbildung in der digitalen Ökonomie verändert hat, im Gutem wie im Schlechtem.
An den amerikanischen Börsen haben die Kurse in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben. Alleine am Freitag ging es mit Dow, S&P-500 und Nasdaq 100 um zwischen zwei und 2,5 Prozent nach unten.
Die abtretende Fed-Vorsitzende Janet Yellen hat am Samstag ihren letzten Arbeitstag. Am Montag beginnt sie bereits bei der Denkfabrik Brookings.
Die SDA-Redaktion hat am Freitagnachmittag nach einem knapp viertägigen Streik die Arbeit wieder aufgenommen. Der Streik sei jedoch nur ausgesetzt, warnen die Redaktoren.
Die Digitalwährung Bitcoin wird derzeit heftig durchgeschüttelt – und zeigt alle Anzeichen einer Spekulationsblase, der Luft entweichen kann. Was steckt dahinter, und wie funktionieren Bitcoins überhaupt? Die wichtigsten Antworten.
Vor einem Jahr mussten sich die Aktionäre des Industrieriesen ABB mit der vagen Aussage zufriedengeben, dass 2017 ein «Übergangsjahr» werde. Für das laufende Jahr wird das Management schwer um eine konkrete Prognose herumkommen. Die Erwartungen an den Geschäftsverlauf sind hoch.
Sinkende Erträge, zu hohe Kosten und kein Silberstreif am Horizont. Das sorgt für zunehmende Kritik am Konzernchef John Cryan. Die Strategie der Bank lautet derzeit «Sparen und hoffen». Das ist den Aktionären zu wenig.
Die Wirtschaft wächst, und die Immobilienpreise ziehen an – bei nach wie vor tiefen Zinsen. Weil auch wieder schlechtere Zeiten kommen können, sollen die Banken bei der Kreditvergabe strenger sein als bisher.
Selbst wenn demnächst die Schuldenobergrenze erhöht werden sollte: Die USA steuern auf eine Krise zu.
Bulgariens Steuerkommissäre haben ein Flair für unorthodoxe Ermittlungsmethoden entwickelt.
Jetzt auch noch Tierversuche an Affen. Autobauer wie VW lassen offenbar keinen Skandal aus. Doch neben eigenen Fehlern bringen auch staatliche Fehlanreize wie die obsessive Fixierung auf das E-Auto die Konzerne in Bedrängnis.
Nach Ansicht des Roche-Konzernchefs Severin Schwan wäre eine Annahme der SVP-«Begrenzungsinitiative» für den Schweizer Wirtschaftsstandort «Gift». Die Einschätzung verdient ernst genommen zu werden, denn ohne Personenfreizügigkeit mit der EU stünden Arbeitsplätze vor allem in der Forschung auf dem Spiel.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Die Sozialsysteme sind nach wie vor häufig auf die traditionellen Arbeitsverhältnisse ausgerichtet. Die wachsende Bedeutung flexibler Arbeitsformen zwingt jedoch zum Umdenken.
Der US-Arbeitsmarkt hat sich auch zu Beginn des neuen Jahres solide entwickelt. Die Arbeitslosenquoten sind inzwischen für alle Bevölkerungsgruppen sehr niedrig.
Die Diskussionen um ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU illustrieren, dass die Schweiz den Fünfer und das Weggli nicht gleichzeitig haben kann.
Österreichs neue Regierung will das System der Arbeitslosenhilfe nach deutschem Hartz-IV-Vorbild reformieren. Damit hat sie eine grosse Aufregung im Land ausgelöst. Aber ein Blick über den Tellerrand ist hilfreich.
Die indische Regierung stellt im Jahreshaushalt ein riesiges Krankenversicherungsprogramm für die ärmsten Bevölkerungsschichten in Aussicht. Kapitalgewinne werden wieder besteuert.
Vier Jahre nach dem Maidan-Umsturz hat sich Enttäuschung über den Reformfortschritt in der Ukraine breitgemacht. Der wichtigste ausländische Berater der ukrainischen Politik vertritt aber eine andere Sicht.
Der Bundesrat beschliesst Eckwerte zur Neuauflage der Unternehmenssteuerreform.
Im Januar ist die jährliche Inflation der Euro-Zone auf 1,3% gesunken. Damit bleibt sie weiterhin tiefer, als der EZB lieb ist. Um genau einen Prozentpunkt zurückgegangen ist im letzten Jahr die Arbeitslosenquote.
Die Firma Marenco hat sich in Kopter umbenannt und eine neue Werkhalle am Flugplatz Mollis bezogen. 2019 will man die ersten Helikopter aus Karbon an die Kunden ausliefern.
Für die Schweizer Stromkonzerne ist Italien der wichtigste Markt. Mit der bevorstehenden gänzlichen Liberalisierung erweitert sich dort ihr Marktpotenzial sogar noch.
Mercedes-Benz hat dank blendenden Geschäften in China ein Rekordjahr hinter sich. Es gibt eine rekordhohe Dividende und eine Mitarbeiterprämie. Doch diese Erfolge werden überschattet von den jüngsten Nachrichten zum Dieselskandal. Das ärgert Daimler-Chef Zetsche.
Der Spielzeugkonzern meldet einen Millionenverlust - trotz eines Comebacks der beliebten Puppe.
Das weltgrösste soziale Netzwerk hat glänzende Zahlen für das per Dezember abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Allerdings verbrachten die Nutzer pro Tag 50 Millionen Stunden weniger Zeit in dem sozialen Netzwerk als noch im dritten Quartal.
Nach VW hat nun auch Daimler einen Mitarbeiter beurlaubt. Er war im Vorstand der Forschungsvereinigung, die die umstrittenen Studien bewilligt hatte. Die Anleger reagierten bisher ziemlich gefasst.
Im Zuge der letztjährigen Übernahme des amerikanischen Kapselherstellers Capsugel hat sich die Nettoverschuldung des Basler Chemiekonzerns Lonza mehr als verdoppelt. Doch die Basler sind auch stark gewachsen – nicht nur dank dem akquirierten Geschäft.
Der Besuch des US-Präsidenten in Davos hat die Schweiz in einen zweiwöchigen Ausnahmezustand versetzt. Wie konnte das geschehen? Das grosse Trump-Theater in vier Akten.
Donald Trump hat seinen Auftritt in Davos gut genutzt, und die ans WEF gereiste Elite zeigte sich ungewöhnlich optimistisch. Doch gerade Europa bleibt akut gefordert und sollte nicht in Überschwang verfallen.
Der Auftritt des amerikanischen Präsidenten am WEF in der Schweiz ist ohne Eklat abgelaufen. Trump machte vor allem Reklame für sein Land und lud internationale Konzerne ein, nun in den USA zu investieren.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fordert einen Beitrag der Bauern bei den Freihandelsgesprächen. In Sachen Verständigung mit der EU solle sich die Schweiz nicht unter Druck setzen lassen, meint er.
US-Präsident Donald Trump hat das diesjährige WEF geprägt wie kein anderer. Mit einer grossen Lobrede auf sich und sein Land sorgte er für das Schlussbouquet. Laut den Behörden soll das WEF künftig nicht noch grösser werden.
US-Präsident Donald Trump hat seine mit Spannung erwartete Rede gehalten. Dabei erfand er das Rad nicht neu, zeigte sich aber beim Thema Freihandel offener als auch schon – und natürlich durfte eine Spitze gegen die «Fake-News» nicht fehlen.
Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat der US-Präsident Donald Trump eine Lobrede auf sich selbst und seine Regierung gehalten. Bei der Handelspolitik hörten sich seine Äusserungen etwas besänftigend an.
Am nächsten Mittwoch macht der Bundesrat seine europapolitische Auslegeordnung. Bundesrat Ueli Maurer erklärt seine Haltung.
Donald Trump hat am WEF in Davos Bundespräsident Alain Berset getroffen und seine Abschlussrede gehalten. Darin verteidigte er seine Politik des «America First» und lobte sein eigenes Wirken sowie die Verdienste seiner Regierung.
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Seit der Bankenkrise 2007/08 wird an den Spielregeln des Finanzmarktes geschraubt. Das Dickicht an Regeln wird immer undurchdringlicher. Es ist höchste Zeit, die Regulierung endlich klar auszurichten.
Banker wie Axel Weber und Aufseher wie Elke König warnen vor neuer Regulierungs-Kleinstaaterei. Bail-in-Kapital bei Bankenpleiten ist oft noch in den falschen Händen. Die Folgen der Krise dauern an.
Rückblick auf die Vorboten der Finanzkrise vor zehn Jahren – die Subprime-Kredite sind zwar gezähmt, doch drohen andere Gefahren.
Es hat lang gedauert, bis sich die Finanzwirtschaft einigermassen aus dem Loch herausgearbeitet hat, in das sie 2007 gefallen war. Es gibt indes Kollateralschäden, die weiter Anlass zur Sorge geben.
Wer sind die Personen, die von Offshore-Geschäften profitieren? In den «Paradise Papers» finden sich Namen von Politikern wie Gerhard Schröder und Juan Manuel Santos bis hin zu Künstlern wie Bono, Shakira und Madonna – eine Übersicht.
Mit den «Paradise Papers» rücken die Steuerpraktiken internationaler Konzerne erneut in den Fokus. Globalen Firmen stehen viel mehr Wege offen als lokalen Konkurrenten, um Steuern zu optimieren.
Die vertraulichen Dokumente haben fragwürdige Investments der beiden königlichen Familienmitglieder aufgedeckt.
Als der Bundesrat 2016 die Kandidatur Monika Ribars zur SBB-Verwaltungsratspräsidentin guthiess, war ihm ihr Mandat in Angola nicht bekannt. Ribar war indes vor Antritt ihres neuen Amtes aus der Firma ausgetreten.
Wie ein Schweiz-Angolaner mit Milliarden jongliert und ein Mittelsmann verdächtig tiefe Bergbaulizenzen aushandelte.
Wie so vieles können auch Offshore-Geschäfte für kriminelle oder fragwürdige Geschäfte missbraucht werden. Sie gehören aber zu einer globalen Wirtschaft. Manchmal sind sie Ausdruck von Missständen, kaum je deren Ursache.
Wer steckt sein Geld in Offshore-Konstrukte? War das legal? Und was steht im jüngsten Datenleck zur Schweiz? Ein Überblick.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zieht sich zwar den Mantel der Wissenschaft über. Sein Buch zur Europäischen Währungsunion verkommt dennoch zum Pamphlet.
Das Verhältnis zwischen den Baslern und ihrer Industrie war und ist nicht immer ein einfaches. Ein neues Buch zeichnet die Verflechtung von Stadt und Chemie nach.
Der Euro–Krise liegen nicht nur divergierende Interessen zugrunde. Zwischen Nord und Süd klafft auch ein ideengeschichtlicher Graben. Ein neues Buch nennt die Gründe dafür.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Guy de Picciotto, Chef der Privatbank UBP, glaubt, dass die Finanzbranche ein neues Kapitel aufschlagen könne. Nach einer Phase der Transformation biete sich die Chance, alte Stärken auszuspielen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft mit ausländischen Vermögen ist keine Goldgrube mehr. Dennoch setzt der Schweizer Finanzplatz auf dieses Geschäft. Vier Experten erklären, wo Banken noch wachsen können und welches die grössten Herausforderungen sind.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Nur jene Banken werden gestärkt daraus hervorgehen, die Althergebrachtes hinterfragen, Innovatives wagen.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigennützig ist. Doch uns sind auch andere Motivationen zu eigen.
Zahlreiche Grosskonzerne und mittelgrosse Firmen schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Vor zehn Jahren als Methode zur Stressbewältigung eingeführt, soll sie heute noch mehr können.
Oft ist es nicht die Arbeit, die Menschen ausbrennen lässt, sondern die Vernachlässigung ihrer Ressourcen. Dem Wichtigsten schenken sie meistens am wenigsten Beachtung: ihrem Bedürfnis nach Bindung.
Die Neurowissenschaften haben bewiesen: Meditation ändert nicht nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch seine Morphologie.
Bosch, Beiersdorf und Axpo flankieren mit Achtsamkeitstraining der Führungskräfte ihre Transformation in agile Unternehmen. Nach anfänglicher Skepsis zieht die Mehrheit der Geschulten positive Bilanz.
Eine Unternehmenskultur ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, das man sich erst leisten sollte, wenn der Laden gut läuft. Achtsamkeit kann vor Fehlentwicklungen schützen.
«Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika alleine», sagte US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum in Davos. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden.
Infizieren, ausspionieren und erpressen, Cyberkriminalität hat viele Facetten. In den letzten Jahren haben dabei die Risiken für Schweizer Unternehmen massiv zugenommen.
Der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin ist im Moment riesig. Doch wie funktioniert die Technologie, die hinter den Bitcoin-Transaktionen steckt?
In Mollis in Glarus baut die Firma Kopter die industrielle Fertigung für den Hubschrauber SH09 auf. Bereits fertiggestellt sind zwei Prototypen.
Das Weltwirtschaftsforum ist in den letzten 48 Jahren zum wichtigsten Treffpunkt für Wirtschaft und Politik geworden. Ein Blick zurück.
Vom Dienstag bis Freitag (23.-26. Januar) trifft sich die politische und wirtschaftliche Elite am Weltwirtschaftsforum in Davos. Das diesjährige WEF steht unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt».
Auch dieses Jahr hat sich wieder viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft am Davoser Weltwirtschaftsforum angemeldet.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Soll die Staatenwelt das Nebeneinander von zwei AIA-Systemen für alle Zukunft akzeptieren? Das darf nicht sein. Die USA sollten den OECD-Standard ebenfalls anwenden.
Die kommende Steuertransparenz inspirierte viele Sünder zu Selbstanzeigen. 2017 haben sich schätzungsweise 35 000 Steuersünder selbst gemeldet.
Die Urheber der Bankgeheimnis-Initiative sehen ihr Hauptziel erreicht und ersparen sich eine Volksabstimmung, die sie nur schwer hätten gewinnen können.


























