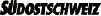
Der Gründer des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, Ingvar Kamprad, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Kamprad schlief in seinem Haus in der südschwedischen Region Småland friedlich ein, wie Ikea am Sonntag mitteilte.
Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er sei am Samstag nach kurzer Krankheit im Alter von 91 Jahren zu Hause gestorben, teilte Ikea am Sonntag mit. Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt.
Die Pharmaindustrie muss der Gesellschaft mehr zurückgeben. Das rät der abtretende Novartis-Chef Joseph Jimenez seiner Branche, um ihre schlechte Reputation zu verbessern. Der Zugang zu Medikamenten müsse für alle Patienten verbessert werden.
Mücken lernen, wenn sich ihre Opfer wehren - und meiden diese daraufhin nach Möglichkeit. Der Effekt ist einer Studie zufolge ähnlich stark wie der von Insektenabwehrmitteln.
Die Fondsgesellschaft Union Investment fürchtet die Zerschlagung der Deutschen Bank. Zuletzt hatte das Geldinstitut erhebliche Marktanteile in den USA verloren.
Donald Trump singt gemeinsam mit unserem RSO-Moderator. Die Grossen und Mächtigen setzen sich für die Rechte der Frauen ein. Und die WEF-Organisatoren fordern eine verkehrsfreie Promenade in Davos. Wir haben für Euch den grossen, multimedialen Rückblick zum diesjährigen WEF.
Der Besuch von US-Präsident Donald Trump war ohne Frage das dominierende Thema am diesjährigen WEF. Für «Südostschweiz»-Wirtschaftsredaktor Stefan Schmid gab es jedoch noch andere Highlights.
Im Februar beginnt die Kraftwerke Zervreila AG mit den Hauptarbeiten zur Sanierung der Nebenanlagen der Staumauer.
Die Deutsche Bahn will einem Zeitungsbericht zufolge in diesem Jahr rund 19'000 neue Mitarbeiter einstellen. Darunter sind allein mehr als 1000 Lokführer und Lokführer-Lehrlinge.
Die Kritik an der Anlagestiftung Ethos zeigt Folgen: Dominique Biedermann, Präsident der Anlagestiftung Ethos, übergibt die Präsidentschaft von Ethos Services an der Generalversammlung im Juni an eine neue Person. Auch das Präsidium der Ethos Stiftung will er abgeben.
Ein chinesisches Staatsmedium zitiert den Davoser Landammann, aber nicht korrekt. Demnach soll das diesjährige WEF-Thema von der Rede von Chinas Präsident Xi Jinping inspiriert sein.
Ab 2020 sollen in St. Moritz nur noch Busse mit elektrischem oder mit Hybridantrieb für den öffentlichen Verkehr zugelassen werden.
Am World Economic Forum in Davos wurde getwittert, was das Zeug hält. Das heisst vor allem eines: Werbung für Davos, die Menschen auf der ganzen Welt erreicht – und das sogar noch gratis.
Das WEF ist zu Ende, und die Schweizer Armee muss in Davos haufenweise Material rückbauen. Wegen der grossen Schneefälle werden einige der Absperrgitter bis im Frühling stehen bleiben.
Die US-Derivateaufsicht CFTC will laut Insidern der Schweizer Grossbank UBS eine Millionenstrafe wegen angeblicher Manipulation an den amerikanischen Terminmärkten auferlegen. Geldbussen sind auch vorgesehen für die Deutsche Bank und das britische Finanzinstitut HSBC.
Für über 16 Milliarden Euro will der italienische Autobahnbetreiber Atlantia den spanischen Konkurrenten Abertis kaufen. Nun ist Atlantia einen Schritt weiter: Der Konzern hat für sein Angebot zur Übernahme grünes Licht von der Regierung in Madrid erhalten.
Somedia wird auch in Zukunft den überregionalen Mantelteil ihrer Tageszeitungen selbst herstellen. Punktuelle Zusammenarbeiten mit anderen Verlagen werden aber nicht ausgeschlossen.
Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo vor dem Jahreswechsel verringert. Zwischen Oktober und Dezember 2017 stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent.
Blockgletscher aus gefrorenem Lockergestein und Schlamm verändern sich wegen der Klimaerwärmung rasch und laufend. Das haben Forschende der ETH Zürich im Turtmanntal herausgefunden. Doch unmittelbare Gefahr droht nicht durch diese Gletscher.
US-Präsident Donald Trump hat Bundespräsident Alain Berset gesagt, er werde aus der Schweiz viel Goodwill in die USA zurückbringen. Im Gegenzug hätte die Schweiz vom wirtschaftlichen Aufschwung in den USA einen grossen Nutzen.
Der Nahrungsmittelriese Nestlé treibt den Stellenabbau in Frankreich weiter voran. Bis zu 400 Jobs sollen rund um Paris abgebaut werden. Für Nizza war vor einigen Monaten schon der Abbau von 450 Stellen angekündigt worden.
Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist erleichtert: Auch das Berufungsgericht in Tokio hat einen ehemaligen Mitarbeiter im Zusammenhang mit einem Liftunfall vor über zehn Jahren freigesprochen.
Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat 2017 den Gewinn um 11,7 Prozent auf 720 Millionen Franken gesteigert. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 4,9 Prozent auf 5,1 Milliarden Franken. In Schweizer Franken betrug das Umsatzwachstum 8,3 Prozent.
Die besten Bilder des 48. Weltwirtschaftsforums in Davos.
Die US-Medienkonzerne Viacom und CBS denken nach Informationen von Insidern über einen Zusammenschluss nach. Viacom-Chef Bob Bakish und CBS-Chef Leslie Moonves hätten bereits Gespräche über eine Fusion geführt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Der Getriebelärm eines ganzen Helikopter-Geschwaders kündete die Ankunft des US-Präsidenten in Davos an. Seine Landung auf dem WEF-Flugfeld beim Davosersee wurde von vielen Medien und Schaulustigen verfolgt. Einige bekamen nur seine Schuhe zu sehen.
Der Körperkult nimmt immer extremere Formen an. Nun will das 1. Glarner Lehrlingsforum Gegensteuer geben. Dahinter stehen die Glarner Handelskammer und der Gewerbeverband des Kantons Glarus.
Der Apartment-Vermittler Airbnb hat laut einem Zeitungsbericht erstmals in seiner Firmengeschichte ein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen. Das 2008 gegründete Unternehmen habe 2017 vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen rund 100 Millionen Dollar verdient.
Die Kaffeerestaurant-Kette Starbucks hat Anlegern trotz Rekordumsätzen zum Jahresende keine Freude machen können. Vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr missfiel.
Der Chip-Hersteller Intel hat dank starken Wachstums im Geschäft mit Datenzentren sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr 2017 Rekorderlöse verbucht. Bei Anlegern kam das gut an, die Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst um rund vier Prozent zu.

Die deutsche Familie Reimann ist in den USA in das Geschäft mit Softdrinks eingestiegen. Damit setzt sie ihren Richtungswechsel fort. Früher hatte sie vornehmlich in Lifestyle- und Modemarken investiert.
Die deutsche Familie Reimann hat es mit dem Aufbau eines Kaffeekonzerns bereits mit Nestlé aufgenommen. Nun greift sie in den USA auch die Getränkegiganten wie Pepsico an.
Der Pharmakonzern Sanofi hat am Montag den Kauf der belgischen Ablynx für 3,9 Mrd. € angekündigt. In der Vorwoche hatten die Franzosen schon den Erwerb der US-Unternehmung Bioverativ für 11,6 Mrd. $ bekanntgegeben.
Ein Forschungsverein hat mit Unterstützung von VW, BMW und Daimler Versuche an Affen und an Menschen durchgeführt. Was ist erlaubt? Was sind die Hintergründe der Tests?
In Europa gibt es noch immer viel zu viele Stahlwerke. Insofern kommen die Restrukturierungspläne, die der Luzerner Hersteller Schmolz + Bickenbach in Frankreich verfolgen will, wie gerufen.
Die Jahresabschlüsse von Carillion werden nochmals überprüfen. Anfang dieses Jahres kollabierte das Unternehmen unter seiner Schuldenlast.
Ein von Volkswagen, BMW und Daimler mitgegründeter Forschungsverein hat die Auswirkungen von Schadstoffen aus Autos an Menschen und an Affen getestet. Die Konzerne zeigen sich entrüstet.
In einigen Entwicklungsländern machen die Geldüberweisungen von Migranten über einen Fünftel der Wirtschaftskraft aus. Dennoch wurde die Diaspora in der Entwicklungspolitik lange vernachlässigt. Das beginnt sich zu ändern, auch in der Schweiz.
Die allermeisten Fernsehgeräte kommen aus Asien. Die deutsche Firma Loewe setzt sich gegen diesen Trend zur Wehr. Ihr Chef, Mark Hüsges, will mit einem Mix aus hochstehendem Design und einwandfreier Technik das deutsche Traditionsunternehmen wieder zu altem Glanz führen.
Der Luzerner Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach kann für 245 Mio. € das Gros der Vermögenswerte von Asco Industries in Frankreich übernehmen. Mit dem Erwerb des insolventen französischen Konkurrenten bürdet er sich die Last einer Sanierung auf.
Die Digitalwährung Bitcoin wird derzeit heftig durchgeschüttelt – und zeigt alle Anzeichen einer Spekulationsblase, der Luft entweichen kann. Was steckt dahinter, und wie funktionieren Bitcoins überhaupt? Die wichtigsten Antworten.
Der Besuch des US-Präsidenten in Davos hat die Schweiz in einen zweiwöchigen Ausnahmezustand versetzt. Wie konnte das geschehen? Das grosse Trump-Theater in vier Akten.
Donald Trump hat seinen Auftritt in Davos gut genutzt, und die ans WEF gereiste Elite zeigte sich ungewöhnlich optimistisch. Doch gerade Europa bleibt akut gefordert und sollte nicht in Überschwang verfallen.
Der Auftritt des amerikanischen Präsidenten am WEF in der Schweiz ist ohne Eklat abgelaufen. Trump machte vor allem Reklame für sein Land und lud internationale Konzerne ein, nun in den USA zu investieren.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fordert einen Beitrag der Bauern bei den Freihandelsgesprächen. In Sachen Verständigung mit der EU solle sich die Schweiz nicht unter Druck setzen lassen, meint er.
US-Präsident Donald Trump hat das diesjährige WEF geprägt wie kein anderer. Mit einer grossen Lobrede auf sich und sein Land sorgte er für das Schlussbouquet. Laut den Behörden soll das WEF künftig nicht noch grösser werden.
US-Präsident Donald Trump hat seine mit Spannung erwartete Rede gehalten. Dabei erfand er das Rad nicht neu, zeigte sich aber beim Thema Freihandel offener als auch schon – und natürlich durfte eine Spitze gegen die «Fake-News» nicht fehlen.
Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat der US-Präsident Donald Trump eine Lobrede auf sich selbst und seine Regierung gehalten. Bei der Handelspolitik hörten sich seine Äusserungen etwas besänftigend an.
Am nächsten Mittwoch macht der Bundesrat seine europapolitische Auslegeordnung. Bundesrat Ueli Maurer erklärt seine Haltung.
Vom Dienstag bis Freitag (23.-26. Januar) trifft sich die politische und wirtschaftliche Elite am Weltwirtschaftsforum in Davos. Das diesjährige WEF steht unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt».
Die grösste Immobilientransaktion in Grossbritannien beläuft sich neuerdings auf 1,6 Mrd. £. Das Auftreten des malaysischen Staats als grosszügiger Käufer des legendären Battersea-Komplexes in London riecht angesichts der Immobilienkrise aber nach einem Bail-out.
Walmart arbeitet weiterhin mit Hochdruck am Ausbau seines Online-Geschäftes. Auch weil Amazon offensichtlich ein Auge auf das Lebensmittelgeschäft geworfen hat – dieses ist aber eine der Säulen von Walmart. Entsprechendes Know-how soll nun auch aus Japan kommen.
Die EU-Kommission büsst Qualcomm mit einer Milliarde Euro, weil der Chiphersteller eine hohe Summe an Apple dafür bezahlt hat, dass der iPhone-Hersteller nur Qualcomm-Chips in Telefone und iPads verbaut. Offenbar ist man in Brüssel der Meinung, dass das die Innovation in Cupertino gebremst hat.
Die Schwierigkeiten der stark verschuldeten Firma HNA dürften Folgen haben für die Akquisitionsaktivitäten chinesischer Firmen im Westen.
Donald Trump hat seinen Auftritt in Davos gut genutzt, und die ans WEF gereiste Elite zeigte sich ungewöhnlich optimistisch. Doch gerade Europa bleibt akut gefordert und sollte nicht in Überschwang verfallen.
Am Davoser Weltwirtschaftsforum (WEF) erfreuten sich die Teilnehmer an der weltweit guten Wirtschaftskonjunktur. Es wären aber keine Ökonomen anwesend gewesen, wenn es nicht einige Aber gegeben hätte.
Ist vom Welthandel die Rede, geht es seit geraumer Zeit vor allem um Protektionismus und Abschottung. Gar so düster steht es aber nicht um den globalen Handel, ganz im Gegenteil.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Angesichts möglicher neuer US-Sanktionen verschleiert Russland die Geschäfte von Unternehmen und schirmt den Rüstungssektor ab. Dazu hilft sich der Kreml mit einer ungewöhnlichen Bankenrettung.
Vor fünf Jahren stand Zypern im Epizentrum der Finanzkrise. Inzwischen steht die Mittelmeerinsel wieder souverän auf eigenen Beinen. Doch verleitet der Höhenflug dazu, über Altlasten hinwegzusehen.
Auf die britische Finanzindustrie soll der Brexit im Vergleich nur wenige Auswirkungen haben.
Die digitalisierte Welt eröffnet dem Gesundheitswesen viele Chancen. Die rasche Verfügbarkeit von Informationen führt dazu, dass Patienten zunehmend Ärzten und Pflegenden auf Augenhöhe begegnen.
Im Schlussquartal 2017 hat sich das BIP-Wachstum in den USA zwar etwas verlangsamt. In der kurzen Frist sind die Aussichten aber gut für die nach wie vor grösste Volkswirtschaft der Welt.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann fordert einen Beitrag der Bauern bei den Freihandelsgesprächen. In Sachen Verständigung mit der EU solle sich die Schweiz nicht unter Druck setzen lassen, meint er.
Der amerikanische Präsident versetzt mit seiner Ankunft Davos in Aufregung. US-Regierungsvertreter haben bereits im Vorfeld von Trumps Auftritt versucht, dem internationalen Publikum die Amerika-zuerst-Politik schmackhaft zu machen.
Am nächsten Mittwoch macht der Bundesrat seine europapolitische Auslegeordnung. Bundesrat Ueli Maurer erklärt seine Haltung.
Der Genfer Staatsanwalt Yves Bertossa bezichtigt den ehemaligen Vermögensverwalter L. M. von der Credit Suisse des gewerbsmässigen Betrugs, der Urkundenfälschung und der ungetreuen Geschäftsführung.
Der vom saudischen Staat kontrollierte Rohstoffkonzern Sabic übernimmt vom US-Investor White Tale 25% der Clariant-Aktien. In Muttenz atmet man auf.
Der saudische Petrochemieriese Sabic erwirtschaftet im operativen Geschäft Margen von über 20%. Er verdankt dies vor allem günstigem Erdgas, das in Saudiarabien zu Preisen deutlich unter dem Weltmarktniveau erhältlich ist.
Die jetzige Alleinaktionärin von Swissport, die chinesische HNA-Gruppe, legt einen etwas unverbindlichen Plan vor, das Unternehmen an die Börse zu bringen.
Seit zwei Jahren steht Sergei Gorkow an der Spitze der russischen Entwicklungsbank VEB. Er versucht unter anderem, das kremlnahe Institut, das von westlichen Sanktionen betroffen ist, in einen Investor für Technologien wie Blockchain umzuwandeln. Bekannt wurde Gorkow aber dadurch, dass er nach dem Wahlsieg von Donald Trump dessen Schwiegersohn Jared Kushner getroffen hatte.
Im Internet liefern sich Migros und Coop mit ihren Online-Shops Le Shop und Coop@home ein erbittertes Duell. Die jüngste Schlacht fechten sie an der virtuellen Frischetheke aus.
Während Migros-Tochterfirmen wie Globus und Ex Libris ihre Produkte mittlerweile auf der Plattform von Galaxus anbieten, stehen noch immer unterschiedliche Logistiksysteme dahinter. Ein Besuch bei Ex Libris in Dietikon zeigt, wieso.
Wer sind die Personen, die von Offshore-Geschäften profitieren? In den «Paradise Papers» finden sich Namen von Politikern wie Gerhard Schröder und Juan Manuel Santos bis hin zu Künstlern wie Bono, Shakira und Madonna – eine Übersicht.
Mit den «Paradise Papers» rücken die Steuerpraktiken internationaler Konzerne erneut in den Fokus. Globalen Firmen stehen viel mehr Wege offen als lokalen Konkurrenten, um Steuern zu optimieren.
Die vertraulichen Dokumente haben fragwürdige Investments der beiden königlichen Familienmitglieder aufgedeckt.
Als der Bundesrat 2016 die Kandidatur Monika Ribars zur SBB-Verwaltungsratspräsidentin guthiess, war ihm ihr Mandat in Angola nicht bekannt. Ribar war indes vor Antritt ihres neuen Amtes aus der Firma ausgetreten.
Wie ein Schweiz-Angolaner mit Milliarden jongliert und ein Mittelsmann verdächtig tiefe Bergbaulizenzen aushandelte.
Wie so vieles können auch Offshore-Geschäfte für kriminelle oder fragwürdige Geschäfte missbraucht werden. Sie gehören aber zu einer globalen Wirtschaft. Manchmal sind sie Ausdruck von Missständen, kaum je deren Ursache.
Wer steckt sein Geld in Offshore-Konstrukte? War das legal? Und was steht im jüngsten Datenleck zur Schweiz? Ein Überblick.
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Seit der Bankenkrise 2007/08 wird an den Spielregeln des Finanzmarktes geschraubt. Das Dickicht an Regeln wird immer undurchdringlicher. Es ist höchste Zeit, die Regulierung endlich klar auszurichten.
Banker wie Axel Weber und Aufseher wie Elke König warnen vor neuer Regulierungs-Kleinstaaterei. Bail-in-Kapital bei Bankenpleiten ist oft noch in den falschen Händen. Die Folgen der Krise dauern an.
Rückblick auf die Vorboten der Finanzkrise vor zehn Jahren – die Subprime-Kredite sind zwar gezähmt, doch drohen andere Gefahren.
Es hat lang gedauert, bis sich die Finanzwirtschaft einigermassen aus dem Loch herausgearbeitet hat, in das sie 2007 gefallen war. Es gibt indes Kollateralschäden, die weiter Anlass zur Sorge geben.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Guy de Picciotto, Chef der Privatbank UBP, glaubt, dass die Finanzbranche ein neues Kapitel aufschlagen könne. Nach einer Phase der Transformation biete sich die Chance, alte Stärken auszuspielen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft mit ausländischen Vermögen ist keine Goldgrube mehr. Dennoch setzt der Schweizer Finanzplatz auf dieses Geschäft. Vier Experten erklären, wo Banken noch wachsen können und welches die grössten Herausforderungen sind.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Nur jene Banken werden gestärkt daraus hervorgehen, die Althergebrachtes hinterfragen, Innovatives wagen.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigennützig ist. Doch uns sind auch andere Motivationen zu eigen.
Zahlreiche Grosskonzerne und mittelgrosse Firmen schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Vor zehn Jahren als Methode zur Stressbewältigung eingeführt, soll sie heute noch mehr können.
Oft ist es nicht die Arbeit, die Menschen ausbrennen lässt, sondern die Vernachlässigung ihrer Ressourcen. Dem Wichtigsten schenken sie meistens am wenigsten Beachtung: ihrem Bedürfnis nach Bindung.
Die Neurowissenschaften haben bewiesen: Meditation ändert nicht nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch seine Morphologie.
Bosch, Beiersdorf und Axpo flankieren mit Achtsamkeitstraining der Führungskräfte ihre Transformation in agile Unternehmen. Nach anfänglicher Skepsis zieht die Mehrheit der Geschulten positive Bilanz.
Eine Unternehmenskultur ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, das man sich erst leisten sollte, wenn der Laden gut läuft. Achtsamkeit kann vor Fehlentwicklungen schützen.
«Amerika zuerst bedeutet nicht Amerika alleine», sagte US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum in Davos. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden.
Infizieren, ausspionieren und erpressen, Cyberkriminalität hat viele Facetten. In den letzten Jahren haben dabei die Risiken für Schweizer Unternehmen massiv zugenommen.
Der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin ist im Moment riesig. Doch wie funktioniert die Technologie, die hinter den Bitcoin-Transaktionen steckt?
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zieht sich zwar den Mantel der Wissenschaft über. Sein Buch zur Europäischen Währungsunion verkommt dennoch zum Pamphlet.
Das Verhältnis zwischen den Baslern und ihrer Industrie war und ist nicht immer ein einfaches. Ein neues Buch zeichnet die Verflechtung von Stadt und Chemie nach.
Der Euro–Krise liegen nicht nur divergierende Interessen zugrunde. Zwischen Nord und Süd klafft auch ein ideengeschichtlicher Graben. Ein neues Buch nennt die Gründe dafür.
Das Weltwirtschaftsforum ist in den letzten 48 Jahren zum wichtigsten Treffpunkt für Wirtschaft und Politik geworden. Ein Blick zurück.
Vom Dienstag bis Freitag (23.-26. Januar) trifft sich die politische und wirtschaftliche Elite am Weltwirtschaftsforum in Davos. Das diesjährige WEF steht unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt».
Auch dieses Jahr hat sich wieder viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft am Davoser Weltwirtschaftsforum angemeldet.
Die Armee und zahlreiche Helfer bereiten die Stadt Davos für das Weltwirtschaftsforum vom 23. bis 26. Januar vor.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Soll die Staatenwelt das Nebeneinander von zwei AIA-Systemen für alle Zukunft akzeptieren? Das darf nicht sein. Die USA sollten den OECD-Standard ebenfalls anwenden.
Die kommende Steuertransparenz inspirierte viele Sünder zu Selbstanzeigen. 2017 haben sich schätzungsweise 35 000 Steuersünder selbst gemeldet.
Die Urheber der Bankgeheimnis-Initiative sehen ihr Hauptziel erreicht und ersparen sich eine Volksabstimmung, die sie nur schwer hätten gewinnen können.


























