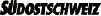
Im Geschäft mit «smarten» Lautsprechern ist Apple bereits im Rückstand, während Amazon mit seinen Echo-Geräten den Markt besetzt. Jetzt wird der iPhone-Hersteller mit seinem HomePod das Weihnachtsgeschäft komplett verpassen, weil er doch noch nicht fertig ist.
Die Lohnverhandlungen zwischen dem Baumeisterverband und den Gewerkschaften Unia und Syna für 2018 sind zumindest vorerst gescheitert. 150 Franken mehr Lohn fordern die Gewerkschafter für Bauarbeiter. Zu viel, sagt Markus Derungs, Präsident des Graubündnerischen Baumeisterverbands, und legt die Gründe dar.
In Deutschland gehen die Proteste gegen die geplanten Stellenstreichungen und Standortschliessungen bei Siemens weiter. Am Montag wollen die Beschäftigten des Gasturbinenwerkes in Berlin eine Menschenkette um ihren Betrieb bilden und diesen damit symbolisch umarmen.
Nach fast zwei Jahren Talfahrt geht es mit der Uhrenindustrie wieder deutlich aufwärts. «Der Aufschwung ist massiv», sagte Swatch Group-Chef Nick Hayek in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».
Wie verhält sich ein Christbaum auf dem Weihnachtsmarkt im Sturm? Forscher haben ein Exemplar im Windkanal getestet und kommen zu beunruhigenden Ergebnissen.
Um Wintersportler aus Madesimo ins Skigebiet Splügen Tambo zu holen, geht das Bergbahnunternehmen ungewöhnliche Wege. Schon diesen Winter will es einen Personentransport über den Splügenpass anbieten.
Die Lohnverhandlungen zwischen dem Baumeisterverband und den Gewerkschaften Unia und Syna für 2018 sind vorerst gescheitert. Die Gewerkschaften verlangen 150 Franken mehr Lohn für die Bauarbeiter, die Baumeister lehnen diese Forderung als übertrieben ab.
Dem US-amerikanischen Getränkehersteller Coca-Cola bläst in Grossbritannien ein scharfer Wind wegen seiner vorweihnachtlichen Truck-Tour entgegen.
Die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat am Freitag ihre Einschätzung über die Bonität der Schweiz mit der Höchstnote AAA bestätigt. Auch der Ausblick für die kommenden Monate wird als stabil eingeschätzt.
Monika Ribar, Verwaltungsratspräsidentin der SBB, taucht in den «Paradise Papers» auf. Im Interview spricht sie über ihr umstrittenes Angola-Mandat.
In Uznach gehen zwei neue Tankstellenprojekte an den Start. Damit wächst die Tankstellendichte an der Zürcherstrasse weiter. Neben Zapfsäulen bringt das sonntägliche Einkaufsmöglichkeiten – zu unterschiedlichen Preisen. Gewerkschafter sehen Sonntagsarbeit kritisch. Auch stellt sich die Frage, ob es ausreichend Kundschaft gibt.
Am Dienstag, 21. November, findet auf dem Postautodeck in Chur der Digitaltag Schweiz statt. Zwölf Stunden lang können sich die Besucher unter anderem über Herausforderungen und Chancen für Unternehmen in Sachen Digitalisierung informieren.
In Kaltbrunn waren die Verbindungsstrasse A53-Gaster und flankierende Massnahmen im Dorfkern Thema an einem Info-Anlass.
Weil er eine Frau vor einem Sexualtäter beschützte, ist der 31-jährige Dübendorfer Remo Schmid am Freitag mit dem «Beobachter Prix Courage» 2017 ausgezeichnet worden. Sein beherztes Eingreifen bewahrte die Frau wahrscheinlich vor einer Vergewaltigung.
Weil das Fondue-Caquelon bei grosser Hitze brechen könnte, ruft Coop das Fondue-Set Swiss Fondue rot der Marke Style'n Cook zurück. Kunden, die das Produkt erworben haben, sollten es nicht verwenden und zurückbringen. Sie erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.
Flumroc aus Flums wechselt den Besitzer und wird dänisch. Dadurch soll aber der Standort Schweiz gestärkt werden und nicht etwa verschwinden.
Die USA schützt mit weiteren Anti-Dumping-Massnahmen den Heimatmarkt gegen vermeintlich zu billige Importe: Das Handelsministerium in Washington hat Strafzölle auf die Einfuhr mechanischer Röhren verhängt. Betroffen sind auch Schweizer Firmen.
Der Chef des japanischen Fahrzeugherstellers Nissan zahlt wegen des Skandals um unzureichende Sicherheitsüberprüfungen einen Teil seines Gehalts zurück.
Genau ein Jahr nach seinem Rücktritt als Armeechef wird André Blattmann Verwaltungsrat der Swiss. Zudem wird mit Jacques Aigrain ein langjähriges Mitglied aus dem Gremium ausscheiden.
EZB-Präsident Mario Draghi hat die Entscheidung zur Fortführung der Niedrigzinspolitik und der Anleihekäufe der Notenbank verteidigt.
Bei der Teilzeitbeschäftigung in der EU ist in fast allen 28 Staaten der Anteil der Männer deutlich geringer als jener der Frauen. Im Durchschnitt sind es 6,7 Prozent der Männer und 29,8 Prozent der Frauen, die teilzeitbeschäftigt sind.
Tesla tut sich gerade schwer damit, die Produktion seines ersten günstigeren Wagens Model 3 hochzufahren. Doch das hält Firmenchef Elon Musk nicht davon ab, mit neuen Ankündigungen vorzupreschen.
Der Bankensoftware-Hersteller Avaloq wird alleiniger Besitzer von Arizon, weil Raiffeisen die Beteiligung daran abstösst. Grund ist die bald abgeschlossene Entwicklung der neuen IT-Plattform für die Bankengruppe.
Das Kantonsgericht blockiert Gelder für eine Forderung, die in Dubai gestellt wurde. Die Supreme-Gruppe mit Briefkästen in Glarus fordert die Freigabe – und läuft auf. Denn die verzweigte Firmenstruktur könnte durchaus dazu dienen, Vermögen zu verstecken und Forderungen auszuweichen.
In der Schweiz halten die Kunden ihrer Hauptbank die Stange: Nur etwas mehr als 1 Prozent der Kunden plant laut einer Umfrage, die Hauptbankbeziehung zu wechseln. Am ehesten wollen noch die Kunden bei Grossbanken wechseln.
Der Umbau der Perronanlage und der Personenunterführung am Bahnhof Felsberg ist nach sechsmonatiger Bauzeit abgeschlossen. Die Infrastruktur wurde an die heutigen Bedürfnisse angepasst und kostete 3.3 Millionen Franken.
Kahlschlag bei Siemens: Der Industriekonzern will in den nächsten Jahren weltweit fast 7000 Arbeitsplätze in zwei Sparten streichen, davon die Hälfte in Deutschland
Bei der Migros-Tochter Digitec Galaxus sind Kundendaten gestohlen worden. Betroffen sind Kunden, welche zwischen 2001 und 2014 bei dem Unternehmen registriert waren.
Wie geht es weiter mit der Poststelle in Laax? Gemeinsam mit der Gemeinde diskutiert die Post derzeit, ob die lokale Postversorgung neu organisiert werden soll.
Trotz des lautstarken Chors jener, die prophezeien, dass durch die Digitalisierung kein Stein auf dem anderen bleiben wird, zeigen sich Schweizer Unternehmer gelassen.

Die EU-Staaten haben Amsterdam als neuen Sitz der EU-Arzneimittel-Agentur EMA erkoren. Neuer Standort für die Bankenbehörde EBA wird Paris.
Der Luzerner Stahlhersteller Schmolz + Bickenbach bietet für den finanziell angeschlagenen französischen Konkurrenten Ascometal. Noch unklar ist, wie viele der knapp 1400 Beschäftigten er übernehmen will.
Fast vierzig Jahre nach der Machtübernahme von Robert Mugabe geht es Simbabwe schlechter als zuvor. Woran liegt das? Die wichtigsten Antworten im Überblick.
Das Scheitern der Jamaica-Sondierungen verunsichert die Wirtschaft. Man brauche mehr als eine geschäftsführende Regierung, heisst es. Zugleich wirkt die deutsche Konjunktur robust und wird auch eine längere Phase der Unsicherheit überstehen.
Aktivistische Investoren sind auf dem Vormarsch. Firmen beauftragen auch schon einmal Headhunter, um ihren Verwaltungsrat dagegen zu rüsten.
Der Finanzinfrastruktur-Konzern SIX streicht bei den Zahlungsdiensten (Payment Services) gegen 100 Arbeitsplätze. Auch der Chef dieser Sparte verlässt die SIX.
So gut waren die Schiffsantriebe von Hallvard Slettevoll, dass ihm der Weltkonzern ABB 2001 das gesamte Geschäft abkaufte. Doch bereits ist der norwegische Ingenieur wieder eine Nasenlänge voraus.
Die nationale Fluggesellschaft Rumäniens wechselt in schneller Folge die Führung aus. Bewirkt hat der Aktionismus wenig. Im Aufwind befinden sich, wie in anderen Balkanstaaten auch, die Anbieter billiger Tickets.
Dem sogenannten Mobile Payment ergeht es wie anderen Innovationen im Zahlungsbereich: Es vergeht viel Zeit, bis die Konsumenten ihre Zurückhaltung ablegen.
Die Unternehmen im Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallsektor verspüren in ihrem Geschäft weiterhin Rückenwind. Im dritten Quartal stiegen die Umsätze branchenweit um über 12%.
Jill Lee, bisher Mitglied des Verwaltungsrats von Sulzer, wird neu den Posten der Finanzchefin beim Winterthurer Pumpenhersteller bekleiden. Sie ersetzt Thomas Dittrich, der zum irischen Pharmakonzern Shire wechselt.
Der Logistikkonzern Panalpina verliert Andy Weber, Chief Operating Officer der Gruppe, auf Ende Jahr.
Menschen glauben, aus guten Gründen zu kaufen. Ihr Unterbewusstsein hat allerdings seine eigenen Motive. Das Neuromarketing versucht diese zu verstehen und kommerziell zu nutzen.
Schon 2019 will Uber selbständig fahrende Autos von Volvo einsetzen.
Der Westen belächelt Chinas Wirtschaft noch gerne. Baidu, Alibaba und Tencent stehen jedoch beispielhaft dafür, dass Arroganz fehl am Platz ist.
Der unter anderem von der Investoren-Legende Warren Buffett praktizierte Value-Stil liegt auch in diesem Jahr hinter dem Growth-Ansatz zurück. Wann dreht der Wind?
Sozialisten aller Parteien schöpfen neue Hoffnung. Dank Big Data betrachten sie das Informationsproblem der Planwirtschaft als gelöst. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.
Für die Montage der Winterräder müssen die Ungarn in diesem Jahr 20 Prozent mehr bezahlen. Dahinter steht ein Phänomen, das derzeit ganz Ostmitteleuropa beschäftigt.
Die Raiffeisengruppe löst die Kapitalverflechtung mit ihrem Softwarelieferanten Avaloq. Ein reines Kundenverhältnis bietet einige Vorteile.
Elektro-Lastwagen und Supersportwagen: Die Ankündigungen des Tesla-Gründers wirken geradezu dreist utopisch. Lieferverzüge und verbranntes Kapital nähren Skepsis. Doch Musk hat schon viel geschafft.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Schweizer Aktien haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Immer wieder kam es aber auch zu Einbrüchen. Was er für die kommenden Jahre erwartet, sagt Stephan Meschenmoser, Anlagestratege des Vermögensverwalters Blackrock, im Video-Interview.
Am Montag entscheiden die EU-Staaten über die neuen Sitze zweier bisher in London angesiedelter EU-Agenturen. Das Verfahren ist kompliziert, der Ausgang ungewiss.
Nowosibirsk existiert nur, weil Zar und Sowjets es so wollten. Heute zehrt Russlands drittgrösste Stadt davon, um sich als Unternehmensstandort zu behaupten. Sie hat durchaus etwas zu bieten.
An einem Gipfeltreffen in Göteborg haben die Spitzen der EU eine «europäische Säule sozialer Rechte» proklamiert. Direkte Auswirkungen hat sie vorerst nicht.
Singapur hat in dieser Woche den Vorsitz der Asean übernommen. Jetzt macht sich der Stadtstaat für ein totales Handelsverbot mit Nordkorea stark.
Die Schweizer Firmen Benteler und Mubea werden des Dumpings bei mechanischen Röhren bezichtigt. Auch auf Lieferungen aus fünf weiteren Ländern erhebt das US-Handelsministeriums Antidumpingzölle.
Früher war der Leitzins das wichtigste Instrument der Notenbank. Dann kamen Wertpapierkäufe und die Orientierung der Märkte über die langfristige Planung dazu. Doch das ist nicht immer erfolgreich, sondern hat Tücken.
Die Welt laboriert an den Folgen der Finanz- und Schuldenkrise. Adair Turner, ehemaliger Chef der britischen Finanzmarktaufsicht und Vorsitzender der Denkfabrik Institute for New Economic Thinking, spricht über den Schuldenüberhang, den Zustand des Kapitalismus und die Skepsis gegenüber Utopien.
Russland verschafft Caracas mit einer weiteren Umschuldung etwas Luft. Auch wenn Moskau zunächst draufzahlt, soll sich der Einsatz nicht nur politisch rentieren.
Bis zu 24 000 Autos wird der schwedische Hersteller zwischen 2019 und 2021 an den Fahrdienstleister Uber verkaufen, die auf autonomes Fahren ausgelegt sind.
Der Aargauer Möbelhersteller De Sede hat nach einer schweren Krise wieder Fuss gefasst und treibt nun die internationale Expansion voran. Chefin Monika Walser hat grosse Pläne für den Traditionskonzern.
Der Genfer Unternehmer Julian Cook will mit Billigflügen den argentinischen Markt erobern. Es ist nicht sein erstes derartiges Projekt. Doch mehr denn je ist er vom Erfolg überzeugt.
Die geplanten Tesla-Lastwagen stossen auf Anklang.
Der Basler Pharmakonzern hat in den USA erstmals die Zulassung für ein Medikament gegen die Bluterkrankheit erhalten. In diesem Markt winkt ein jährlicher Umsatz von 10 Milliarden Dollar.
Der Elektroauto-Hersteller Tesla will auch das Lastwagen-Geschäft aufmischen. Firmenchef Elon Musk stellte in der Nacht zum Freitag einen strombetriebenen Sattelschlepper vor.
Der Entscheid der US-Regierung, gegen zwei Produzenten von Präzisionsstahlrohren aus der Schweiz Strafzölle zu verhängen, sorgt bei den betroffenen Firmen für Unverständnis.
Der selber doppelt beinamputierte MIT-Professor Hugh Herr ist überzeugt, dass Behinderungen eliminiert werden können. Und alle werden mit Biomechanik ihre natürlichen Fähigkeiten optimieren.
Alisée de Tonnac hat ihre Musterkarriere bei L’Oréal an den Nagel gehängt und mit Seedstars World den grössten Start-up-Wettbewerb der Welt gegründet. Im Interview spricht sie über Träume, Innovationskultur und das Potenzial von Schwellenländern.
Wer sind die Personen, die von Offshore-Geschäften profitieren? In den «Paradise Papers» finden sich Namen von Politikern wie Gerhard Schröder und Juan Manuel Santos bis hin zu Künstlern wie Bono, Shakira und Madonna – eine Übersicht.
Mit den «Paradise Papers» rücken die Steuerpraktiken internationaler Konzerne erneut in den Fokus. Globalen Firmen stehen viel mehr Wege offen als lokalen Konkurrenten, um Steuern zu optimieren.
Die vertraulichen Dokumente haben fragwürdige Investments der beiden königlichen Familienmitglieder aufgedeckt.
Als der Bundesrat 2016 die Kandidatur Monika Ribars zur SBB-Verwaltungsratspräsidentin guthiess, war ihm ihr Mandat in Angola nicht bekannt. Ribar war indes vor Antritt ihres neuen Amtes aus der Firma ausgetreten.
Wie ein Schweiz-Angolaner mit Milliarden jongliert und ein Mittelsmann verdächtig tiefe Bergbaulizenzen aushandelte.
Wie so vieles können auch Offshore-Geschäfte für kriminelle oder fragwürdige Geschäfte missbraucht werden. Sie gehören aber zu einer globalen Wirtschaft. Manchmal sind sie Ausdruck von Missständen, kaum je deren Ursache.
Wer steckt sein Geld in Offshore-Konstrukte? War das legal? Und was steht im jüngsten Datenleck zur Schweiz? Ein Überblick.
Die zunehmende Urbanisierung stellt die Städte vor grosse Herausforderungen. Technologien können helfen, diese zu lösen, aber sie allein genügen nicht.
Um die Ansiedelung von Unternehmen zu kämpfen, sind sich Städte und Regionen gewöhnt. Aber auch die mobilen Arbeitskräfte können sich zunehmend aussuchen, von wo aus sie arbeiten – und sie wollen umgarnt sein.
Self-Storage ist in der Schweiz noch wenig verbreitet. Mit PlaceB ist nun aber seit kurzem ein vollständig digitalisierter Anbieter auf dem Markt, der das Mieten von Lagerflächen populär machen könnte. Das Publikum der NZZ Real Estate Days hat PlaceB mit dem «Investors Choice» ausgezeichnet.
Co-Living-Konzepte werden immer beliebter. Auch in der Schweiz dürfte diese Wohnform Potenzial haben.
Der Swissinvest-Immobilienfonds gewinnt erneut den NZZ Real Estate Award für das erfolgreichste Management über die vergangenen fünf Jahre. Die Strategie «Kaufen und halten» scheint sich auch bei Immobilienfonds auszuzahlen.
An den Real Estate Days in Interlaken vom Donnerstag und Freitag stehen die Millennials im Zentrum. An der NZZ-Konferenz werden die Chancen und Risiken der Schweizer Immobilienwirtschaft diskutiert. Verfolgen Sie hier den Live-Stream.
Der Beginn der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit jährt sich zum zehnten Mal. Was nach einer kleinen Sache aussah, entwickelte sich zum globalen Ereignis – mit Nachwehen bis heute. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick.
Seit der Finanzkrise vor zehn Jahren ist das Basler Regelwerk stark angewachsen. Es besteht mittlerweile aus über zwei Millionen Wörtern und umfasst Tausende von Seiten. Doch was steht eigentlich in all diesen Dokumenten?
Wie die Finanzwelt in 33 Jahren aussehen wird: Drei Szenarien zum Jahr 2050 – oder ein Feierabend und drei mögliche Arbeitstage im Leben des Martin Emmenegger.
In den zehn Jahren nach dem Ausbruch der Finanzkrise sind die Schrauben der Regulierung immer fester angezogen worden. Die globalen Regulatoren wenden sich von den Grossbanken den Vermögensverwaltern, Fintech-Unternehmen sowie dem Klimawandel zu und verzetteln sich.
Die Politik der EZB war und ist erfolglos, meint der deutsche Ökonom Thomas Mayer. Er fürchtet gar, der «point of no return» für die Geldbehörde sei überschritten. Am Ende könnte es sogar zum Äussersten kommen.
Der Konkurs von Lehman Brothers hat 2008 zu einem perfekten Sturm an den globalen Finanzmärkten geführt. Intransparenz und Vernetztheit haben dazu beigetragen. Amerikas Banken sind heute gegen eine Krise besser gewappnet.
Seit der Bankenkrise 2007/08 wird an den Spielregeln des Finanzmarktes geschraubt. Das Dickicht an Regeln wird immer undurchdringlicher. Es ist höchste Zeit, die Regulierung endlich klar auszurichten.
Banker wie Axel Weber und Aufseher wie Elke König warnen vor neuer Regulierungs-Kleinstaaterei. Bail-in-Kapital bei Bankenpleiten ist oft noch in den falschen Händen. Die Folgen der Krise dauern an.
Rückblick auf die Vorboten der Finanzkrise vor zehn Jahren – die Subprime-Kredite sind zwar gezähmt, doch drohen andere Gefahren.
Es hat lang gedauert, bis sich die Finanzwirtschaft einigermassen aus dem Loch herausgearbeitet hat, in das sie 2007 gefallen war. Es gibt indes Kollateralschäden, die weiter Anlass zur Sorge geben.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Ohne diese Beschränkung hätte es 2017 Harvard-Professor Kenneth Rogoff auf das Podest geschafft.
An der Spitze des Ökonomen-Rankings der NZZ herrscht Konstanz. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es aber zu bedeutenden Verschiebungen. Diese spiegeln auch den Aufmerksamkeitszyklus von Wirtschaftsthemen.
Das Ökonomen-Ranking der NZZ zeigt: Die Mehrheit der an Schweizer Universitäten lehrenden Volkswirtschaftsprofessoren wird in den Medien und in der Politik nicht wahrgenommen. Das sollte sich ändern.
Insgesamt haben es 42 Wirtschaftswissenschafter in das diesjährige «Ökonomen-Einfluss-Ranking» geschafft. Bei den Institutionen legt die Universität St. Gallen zu, verharrt aber dennoch auf Platz zwei.
Der Schweizer Ernst Fehr übt auch in den Nachbarländern grossen Einfluss aus. In Deutschland muss er jedoch den ersten Platz räumen.
Guy de Picciotto, Chef der Privatbank UBP, glaubt, dass die Finanzbranche ein neues Kapitel aufschlagen könne. Nach einer Phase der Transformation biete sich die Chance, alte Stärken auszuspielen.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft mit ausländischen Vermögen ist keine Goldgrube mehr. Dennoch setzt der Schweizer Finanzplatz auf dieses Geschäft. Vier Experten erklären, wo Banken noch wachsen können und welches die grössten Herausforderungen sind.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Nur jene Banken werden gestärkt daraus hervorgehen, die Althergebrachtes hinterfragen, Innovatives wagen.
Die Wirtschaftswissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigennützig ist. Doch uns sind auch andere Motivationen zu eigen.
Zahlreiche Grosskonzerne und mittelgrosse Firmen schulen ihre Mitarbeiter in Achtsamkeit. Vor zehn Jahren als Methode zur Stressbewältigung eingeführt, soll sie heute noch mehr können.
Oft ist es nicht die Arbeit, die Menschen ausbrennen lässt, sondern die Vernachlässigung ihrer Ressourcen. Dem Wichtigsten schenken sie meistens am wenigsten Beachtung: ihrem Bedürfnis nach Bindung.
Die Neurowissenschaften haben bewiesen: Meditation ändert nicht nur die Funktionsweise des Gehirns, sondern auch seine Morphologie.
Bosch, Beiersdorf und Axpo flankieren mit Achtsamkeitstraining der Führungskräfte ihre Transformation in agile Unternehmen. Nach anfänglicher Skepsis zieht die Mehrheit der Geschulten positive Bilanz.
Eine Unternehmenskultur ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, das man sich erst leisten sollte, wenn der Laden gut läuft. Achtsamkeit kann vor Fehlentwicklungen schützen.
Die Preise vieler Rohstoffe haben sich in den vergangenen Jahren schlecht entwickelt. Ob Privatanleger trotzdem in dem Bereich investieren sollten und welche Möglichkeiten es gibt, erläutert Andreas Homberger vom Vermögensverwalter Hinder Asset Management im Video-Interview.
Im November 2016 liess die indische Regierung völlig überraschend die beiden höchsten Geldscheine des Landes entwerten. Die daraus resultierenden Folgen waren nicht so wie erhofft.
Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Attraktiv wird es auch durch die niedrigen Zinsen. Doch Gold birgt einige Risiken. Carsten Menke, Rohstoff-Experte bei Julius Bär, zeigt im Video-Interview, worauf es ankommt.
Die Netzwerke der Schweizer Wirtschaftselite haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Dies zeigt eine neue Forschungsarbeit.
Wie aus der familiendominierten Chemiefirma Geigy ein internationaler Konzern wurde, zeigt ein neues Buch über «Sämi» Koechlin – mit vielen Anekdoten zum Menschen hinter dem Wirtschaftsführer.
Dass unser Reichtum in der industriellen Revolution wurzelt, ist kaum umstritten. Offen bleibt, warum es überhaupt zu dieser Revolution kam. Der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr sucht Antworten.
Der Historiker Michael Wildt hat ein Büchlein mit dem Titel «Volk, Volksgemeinschaft, AfD» vorgelegt, er sucht in der Geschichte Antworten auf Fragen der Gegenwart.
Zwischen Krisen und Hochkonjunktur: Bruno Bohlhalter hat eine Geschichte der schweizerischen Uhrenindustrie geschrieben, die mit einigen Mythen der Branche aufräumt.
Karl Schweri hat die Geschichte des Schweizer Einzelhandels massgeblich geprägt: Er führte das Discount-Format ein und brachte die Tabak- und Bier-Kartelle zum Einsturz. Seine Strategie? «Versuch und Irrtum».
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zieht sich zwar den Mantel der Wissenschaft über. Sein Buch zur Europäischen Währungsunion verkommt dennoch zum Pamphlet.
Das Verhältnis zwischen den Baslern und ihrer Industrie war und ist nicht immer ein einfaches. Ein neues Buch zeichnet die Verflechtung von Stadt und Chemie nach.
Der Euro–Krise liegen nicht nur divergierende Interessen zugrunde. Zwischen Nord und Süd klafft auch ein ideengeschichtlicher Graben. Ein neues Buch nennt die Gründe dafür.
Der Aargauer Traditionskonzern produziert die Ledersofas in Klingnau. De Sede will aber nicht mehr nur mit Polstermöbeln assoziiert werden, sondern setzt nun auf den Verkauf ganzer Wohnwelten.
Die polnische Grossstadt Lodz wird wegen ihrer vielen Textilfabriken aus dem 19. Jahrhundert gerne mit Manchester verglichen. Doch der Wiederaufschwung hat in dieser Metropole mit 700 000 Einwohnern erst vor wenigen Jahren eingesetzt.
Schwer mit Kohle beladene Lastwagen aus der Mongolei durchqueren die Wüste Gobi in Richtung chinesische Grenze. Der Fotograf Rentsendorj Bazarsukh hat seine Landsleute Ende Oktober auf ihrer Fahrt begleitet.
In Aarberg (BE) und in Frauenfeld entsteht aus Erdresten, die beim Waschen von Zuckerrüben übrig bleiben, frische Erde für Garten-, Zimmer- oder Balkonpflanzen. Die Herstellung beruht auf einem ausgeklügelten Verfahren und ist hoch automatisiert.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
Peking verstärkt mit dem Beginn des Winters den Kampf gegen die Luftverschmutzung. Das hat Auswirkungen auf die globalen Rohwarenmärkte.
Der Erdölpreis verharrt auf niedrigem Niveau, grosse Produzenten sind in die Bredouille geraten. Doch mancher Anbieter kann mit den tiefen Preisen gut leben.
Kaffee wird weltweit konsumiert. Die Mengen und die Art sind aber sehr unterschiedlich. Neue Kreationen, etwa vom Zapfhahn, sollen den Konsum ankurbeln.


























