
Donald Trump tritt forsch auf und stellt traditionelle Positionen infrage. In Finanzfragen ist aber ein berechenbares Vorgehen gefragt. Der designierte Finanzminister scheint sich dessen bewusst.
Das Pharmageschäft von Novartis stagniert, die Gewinne sind rückläufig, die Margen ebenfalls. Alle Hoffnungen ruhen nun darauf, dass es 2018 zur grossen Trendwende kommt.
Uber ist in aller Munde. Nun lanciert Patrick Favre, ehemaliger Präsident von taxisuisse, selbst eine App, um Taxifahrten zu buchen. Die neue App ist nur auf den ersten Blick gleich wie diejenige von Uber.
Washington bezichtigt Peking, seine Agrarproduktion illegal zu subventionieren. Der Umgangston zwischen den führenden Handelsmächten wird rüder.
Der Handelsbilanzüberschuss von umgerechnet 58 Mrd. $ gegenüber Amerika im Jahr 2016 kommt Trump gerade recht. Er wirft Japan vor, den Export von Autos zu behindern.
Die Schweiz gehört zu einer Spitzengruppe von Ländern, deren Verwaltungen als kaum korrupt gelten. Transparency International lobt Georgien und Senegal für die Bekämpfung der Alltagskorruption.
Bei den Titlis-Bergbahnen ist der Verkehrsertrag im vergangenen Geschäftsjahr geschrumpft. Dafür verantwortlich ist eigentlich ein Erfolgsmerkmal der Firma.
Die Euro-Zone kämpft mit grossen Problemen. Viele Ökonomen haben das schon vor 25 Jahren vorhergesagt. Doch nicht mit allem lagen sie richtig, und ein Problem haben sie gar völlig übersehen.
So gut wie jetzt war die Geschäftslage seit fünf Jahren nicht mehr, sagen die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen. Der Ausblick allerdings hat sich eingetrübt - wobei das Bild noch widersprüchlich ist.
Ungeachtet von Protesten aus Nachbarländern hat die deutsche Regierung eine Pkw-Maut beschlossen. Der neue Vorschlag setzt einen Kompromiss mit der EU-Kommission um.
Die EU fordert von China, dem Bekenntnis von Staatschef Xi Jinping Taten folgen zu lassen. China hat eine Öffnung für Auslandsinvestitionen angekündigt, bleibt beim Zeitplan der Umsetzung aber vage.
Der Chemiekonzern Lonza ist in seinem angestammten Geschäft zurzeit schwungvoll unterwegs. Nach der milliardenschweren Übernahme der US-Firma Capsugel wird deren Integration jedoch kein Spaziergang.
Das Augenheil-Geschäft von Novartis könnte verkauft werden. Zuvor allerdings müssten einige Probleme gelöst werden.
Peking bringt sich in Position, um zum Zugpferd der Globalisierung zu werden. Die USA und Europa überlassen China das Feld. Das ist aber nicht in ihrem Interesse.
Wenn nicht Gegensteuer gegeben wird, wird das US-Haushaltsdefizit in den kommenden Jahren stark zunehmen, und die Schulden werden steigen. Der neue Präsident will aber von alldem nichts wissen.
Zu wenig, zu spät. So lässt sich die Reaktion der türkischen Zentralbank auf den Sinkflug der Lira zusammenfassen. Für eine Trendumkehr braucht es mutigere Schritte.
Die Energiewende nach deutschem Rezept will kaum ein anderes Land kopieren. Teile davon könnten jedoch übernommen werden, heisst es in einer internationalen Studie des Weltenergierats (WEC).
In der Affäre um dubiose Zahlungen an den malaysischen Ministerpräsidenten Najib Razak und den Fonds 1MDB zieht sich die Schlinge zusammen. Ein Grund ist das Geständnis eines verurteilten Schweizers.
Schaut man auf die Zahlen der Anti-WEF-Protestler in Davos, scheint den Globalisierungsgegnern die Lust am Demonstrieren vergangen zu sein. Doch diese Aussage greift zu kurz, wie unser Video zeigt.
In der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative spielt der Inländervorrang bei Arbeitsstellen eine wichtige Rolle. Was das für Firmen konkret bedeutet, erklärt Roland A. Müller, der Direktor des Arbeitgeberverbandes.
Das Ja zum Brexit zog den Kurs des britischen Pfunds am Devisenmarkt auf ein historisches Tief. Doch die Krise der Währung begann lange vorher.
Südamerikas Börsen haben ein Rekordjahr hinter und wahrscheinlich auch eines vor sich. Dafür sprechen insbesondere die steigenden Rohwarenpreise und die anziehende Konjunktur.
Anbieter von «binären Optionen» locken mit hohen Gewinnchancen. Im Schnitt verlieren die Kunden jedoch systematisch Geld. Zu allem Überfluss tummeln sich schwarze Schafe in der Branche.
Nestlé geht ungewohnte Wege. Der frisch erkorene CEO, Ulf Schneider, ist kein Nestlé-Mann, und seine Kompetenz hat er sich auch nicht in der Welt der Konsumgüter erworben.
Trotz sinkenden Mieten ziehen Immobilien die Investoren weiterhin an wie das Licht die Motten. Besonders ein Segment droht heisszulaufen.
Die Reform der US-Aufsicht als Reaktion auf die Finanzkrise war nötig, ging aber zu wenig weit. Einmal mehr hat man es nicht geschafft, Ordnung ins Chaos zu bringen.
Donald Trump will den Freihandelsvertrag Nafta neu verhandeln – das Thema überschattet den Besuch von mexikanischen Regierungsvertretern in Washington. Was steht auf dem Spiel? Die wichtigsten Fragen im Überblick.
Rentable KMU erhalten mit den geplanten Steuerreformen bei Bund und Kantonen im Mittel prozentual höhere Steuervergünstigungen als Grosskonzerne. Ein Blick darauf, wer von der Abstimmung am 12. Februar profitieren könnte und wer nicht.
Die Korruption hat nach Einschätzung von Transparency International im vergangenen Jahr zugenommen. Es gebe mehr Länder, in denen sich die Lage 2016 verschlechtert habe, als solche, in denen sich die Situation verbessert habe, heisst es im Ranking.
Ein kühner Plan der finnischen Verkehrsministerin, beim Strassenverkehr das Verursacherprinzip mehr zum Tragen zu bringen, hat viel Staub aufgewirbelt – und hat drastische Auswirkungen auf die Autoverkäufe.
Am Worldwebforum wurde Bundesrat Johann Schneider-Ammann das «Digitale Manifest» überreicht. Darin schlagen Vertreter aus Politik und Wirtschaft Massnahmen vor, um die Digitalisierung in der Schweiz zu bewältigen.
Die türkische Notenbank enttäuscht die Märkte mit ihrem Zinsentscheid. Die Lira setzt ihren Tiefflug fort.
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada hat mit der Zustimmung des Handelsausschusses im EU-Parlament ein wichtiges Etappenziel erreicht. Doch der Weg ist noch lang.
Barack Obama wollte die Präsenz der USA in Asien stärken. Ein Instrument sollte die Transpazifische Partnerschaft TPP sein, von der Donald Trump nichts hält. Peking wird die Gunst der Stunden nutzen.
Eine Immobilie zu erwerben und sie selbst zu bewohnen, gilt als Königsweg der Altersvorsorge. Welche Vor- und Nachteile der Kauf von Liegenschaften hat, erklärt Donato Scognamiglio, Chef des Beratungsunternehmens Iazi, im Video-Interview.
Mit der Vorsorge in der Säule 3a lassen sich Steuern sparen. Welche Produkte sich hier am besten eignen, erklärt Damian Gliott von der Finanzberatungsgesellschaft Vermögenspartner im Video-Interview.
Bei Anlegern ist das Etikett der Nachhaltigkeit in Verruf gekommen. Zu viele Produkte tragen das Emblem, zudem gelten sie als teuer. Warum die Vorurteile nicht stimmen, erklärt Mirjam Staub-Bisang, CEO der Independent Capital Group, in einem Video-Interview.
Die hohe Nachfrage nach Biotech-Medikamenten treibt das Geschäft von Lonza an. Am Basler Hauptsitz droht dem Chemieunternehmen wegen zahlreicher Neueinstellungen der Platz für Büros auszugehen.
Der Computerperipherie-Hersteller Logitech hat noch nie so gut gearbeitet wie im vierten Quartal 2016. Die Gewinnprognosen wurden nach oben angepasst; an der Börse sprang der Aktienkurs in die Höhe.
Die Grossbank UBS hat sich im Private Banking bisher eher auf Männer ausgerichtet. Jetzt will sie reiche Frauen für sich gewinnen. Sie haben andere Anlagestrategien als Männer.
Brötchenbacken ist eine anspruchsvolle Sache, wie der Fall von Aryzta zeigt. Fehleinschätzungen des Managements können zu «Gewinnwarnungen» und diese zu Aktienkurseinbrüchen führen.
Konzernchef James Hogan verlässt die Fluggesellschaft Etihad. Der Weggang markiert eine Zäsur. Die von Abu Dhabi aus geführte Airline hat sich mit Beteiligungen an Air Berlin und Alitalia die Finger verbrannt.
Fintech-Unternehmen haben die Anforderungen des Finanzgeschäfts unterschätzt. Sie suchen deshalb die Nähe zu etablierten Banken.
Die Zusammenarbeit mit Fintech-Unternehmen verlangt etablierten Banken einen Balanceakt ab. Ob dieser gelingen kann, hängt massgeblich davon ab, ob die Banken bereit sind auf die neuen Spieler zuzugehen.
Harvard-Professorin Carmen Reinhart lobt Irland und tadelt Italien bei der Bewältigung der Finanzkrise. Mit Blick auf die Geschichte bereitet ihr die von Donald Trump geplante Handelspolitik Sorgen.
Das WEF in Davos sorgt für jede Menge Geschäftsflug-Landungen. Was für Kloten beinahe schon Routine ist und den Flughafen St. Gallen-Altenrhein erfreut, wird in Dübendorf eher skeptisch betrachtet.
Die Finanzierung der EU ist ein ewiger Streitfall. Der ehemalige EU-Kommissar Monti soll eine Reform anstossen. Die Ideen liegen nun vor. Für sein Heimatland ist er pessimistisch, erwartet aber keinen Euro-Austritt.
Die Welt steht kopf: Die Wut vieler Bürger verunsichert das Establishment, die USA driften in Richtung Protektionismus, und China feiert sich als Retter des Freihandels. Wie weiter mit der Globalisierung?
Die Entwicklungshilfeorganisation geisselt in einer Studie die Ungleichgewichte in der globalen Vermögensverteilung. Diese ist ungerecht, der Bericht ist aber auch eine ungewollte Werbung für Aktien.
Beim Ausblick auf die Weltwirtschaft am WEF in Davos zeigten sich Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft kurzfristig positiv gestimmt, wiesen aber auf die grosse politische Unsicherheit hin.
Wer einen Bohrer braucht, muss nicht die Technik dahinter verstehen. Diese Logik gilt auch für die Werkzeuge der digitalen Zukunft. Wie werden jedoch die neuen Fertigkeiten am besten vermittelt?
Die Technologie macht beim selbstfahrenden Auto rasante Fortschritte. Doch Mobilität ist auch eine soziale Tätigkeit. Das birgt Probleme.
Die Welt ist im Wandel und mit ihr die Wirtschaft. Was erwartet uns 2017? Eine hochkarätige Runde diskutiert in Davos die drängendsten Fragen und gibt einen Ausblick.
«Blender, Hochstapler und Möchtegern-Diktator», nannte der Multimilliardär, George Soros, den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Mitspielen könnte bei der Wut des Investors auch, dass er viel Geld bei der Wahl Trumps verloren hat.
Niemand in Davos kann Donald Trump leiden – wirklich niemand? Doch, eine kleine Gruppe am Weltwirtschaftsforum blickt der neuen Ära entzückt entgegen: die Banker.
In Davos hat die britische Premierministerin Theresa May für einen aktiveren Staat geworben. Sie will den Spagat zwischen der Globalisierung und der Rücksichtnahme auf die Verlierer dieser Entwicklung schaffen. Versöhnliche Töne gab es in Richtung EU – die der deutsche Finanzminister Schäuble erwiderte.
In der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative spielt der Inländervorrang bei Arbeitsstellen eine wichtige Rolle. Was das für Firmen konkret bedeutet, erklärt Roland A. Müller, der Direktor des Arbeitgeberverbandes.
2017 sollen die Krankenkassenprämien wieder erhöht werden, je nach Kanton zwischen 3,5 und 7,3 Prozent. Ein Experte erklärt im Video-Interview, wie Versicherte ihre Kosten reduzieren können.
Die britische Wirtschaft muss sich nach dem Brexit auf harte Zeiten einstellen. Auch in Europa und in der Schweiz werden die Folgen zu spüren sein, wie Konjunkturforscher Jan-Egbert Sturm im Interview erklärt.
Der Euro–Krise liegen nicht nur divergierende Interessen zugrunde. Zwischen Nord und Süd klafft auch ein ideengeschichtlicher Graben. Ein neues Buch nennt die Gründe dafür.
Wem gegen Ende der Laufbahn gekündigt wird, der tut sich im Arbeitsmarkt oft schwer. Die Autorin Isabel Baumann hat dies am Beispiel entlassener Schweizer Industriebeschäftigter untersucht.
Finanz- und Euro-Krise haben die Glaubwürdigkeit der Ökonomie erschüttert. FAZ-Redaktor Philip Plickert hat nun ein Buch publiziert, das die Gedanken der Zweifler und Kritiker aufnimmt.
In der Marktwirtschaft gibt es Anreize, sich unanständig zu verhalten. Tut man es nicht, wird man ersetzt durch solche, die es tun – eine provokative These zweier Nobelpreisträger.
In der Saga um die Griechenland-Krise ab 2009 sieht kaum ein Beteiligter gut aus. Daran erinnert nun das Buch eines Insiders, der fast im Gefängnis landete.
Nicht Kapital oder Institutionen haben im Zug der industriellen Revolution den Aufschwung ermöglicht, sondern die Akzeptanz bürgerlicher Tugenden. Diese These verficht Deirdre McCloskey überzeugend.
Alusuisse war einst ein stolzer Schweizer Industrieriese. 2000 fusionierte die Gruppe mit dem kanadischen Konkurrenten Alcan. Die 2005 aus einem Spin-off hervorgegangene Firma Novelis ging ein Jahr später im indischen Mischkonzern Aditya Birla auf. Das aus einer weiteren Abspaltung hervorgegangene Unternehmen Constellium wurde 2011 gegründet. Trotz diesen vielen Wechseln werden im Wallis weiterhin im grossen Stil Produkte aus Aluminium hergestellt.
Damenmodelle stehen am diesjährigen Genfer Uhrensalon bei vielen der anwesenden Luxusmarken im Mittelpunkt. Wie immer gibt es aber auch spektakuläre Kreationen zu sehen.
Vom 17. bis 20 Januar findet in Davos das 47. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt. 3000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst diskutieren die drängenden Fragen der Gegenwart.
Das 47. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos hat offiziell begonnen. Bis Freitag wird die Bündner Stadt zum «Zauberberg», auf dem sich Spitzenpolitiker und Wirtschaftskapitäne, Wissenschafter und Künstler die Klinke in die Hand drücken.
Experten wissen es bereits, die Menschen spüren es zumindest: Die vierte industrielle Revolution der Digitalisierung wird den Alltag in fast allen Bereichen noch einmal markant verändern.
Werner Vogels, Technikchef von Amazon, erklärt, wie der Cloud-Dienst «Amazon Web Services» die Daten seiner Kunden vor Hackern und Behörden schützt.
Im Zuge der «digitalen Revolution» könnte jede zweite Stelle verloren gehen, heisst es in Studien. Das düstere Szenario unterschätzt die Wandelbarkeit des Menschen und verkennt seine grösste Stärke.
2016 konnten die Rohwarenpreise wieder etwas Luft holen. Ein Anziehen von Teuerung und Wirtschaftswachstum sowie schuldenfinanzierte Infrastrukturprogramme werden die Erholung weiter stützen.
An den Finanzmärkten wird mit einer rasch steigenden Inflation gerechnet. Privatanleger sollten sich auf das neue Preisumfeld einstellen und ihre Depots darauf vorbereiten.
Das nun seit dem Jahr 2009 anhaltende Rally am amerikanischen Aktienmarkt dürfte sich auch im kommenden Jahr weiter fortsetzen.
In dieser Woche hat es am Schweizer Kapitalmarkt eine Premiere und eine Fast-Premiere gegeben. Und die Banken schauen als Kreditgeber immer häufiger in die Röhre.
In Zeiten extrem tiefer Zinsen sind die Ausschüttungen von Firmen eine Möglichkeit, laufende Einnahmen zu erzielen. Vor allem auch dann, wenn sie zudem noch steuerfrei sind.
An den Finanzmärkten wartet man auf protektionistische Handelsmassnahmen der USA. Diese sind äusserst umstritten. Es gibt aber auch Stimmen, die Vorteile für möglich halten.
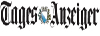
Erstmals hat der US-Leitindex Dow Jones 20'000 Punkte überschritten. Eine baldige Korrektur an der Börse ist aber möglich.
Eine Liste von Linkedin zeigt, wie sich die Nutzer am liebsten beschreiben. Im Vergleich zu den Deutschen sind die Schweizer eher selbstbewusst.
Der Trump-Effekt: Der wichtigste Börsenindex der USA klettert eine Woche nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten auf ein neues Allzeithoch.
In der Schweiz zieht die Inflation wieder an – wenn auch nicht im selben Ausmass wie in Nachbarländern. Das Sparkonto wird damit endgültig zu einem Verlustgeschäft.
Manager Michael Rechsteiner verteidigt den 14,5-Milliarden-Transfer von General Electric.
Mit einem Gewinn von 97 Millionen Dollar im dritten Quartal hat der Computerzubehör-Hersteller Logitech selbst nicht gerechnet.
Die Zugriffe auf den Schweizer Datenanbieter sind abgestürzt. Nun droht noch eine Niederlage am Bundesverwaltungsgericht.
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ist optimistisch, was die US-Konjunktur betrifft. Er hofft sogar auf ein Freihandelsabkommen. Doch auch die EU bleibe wichtig.
Der Pharmakonzern will nach einer Schwächephase bald wieder durchstarten. Dazu beitragen könnte auch ein Verkauf der Problemsparte Alcon.
Das Transpazifische Handelsabkommen sei gescheitert, meint Wirtschaftsprofessor Patrick Ziltener. Für die Schweiz sei dies nicht unbedingt schlecht.
Für die Stilllegung von Fessenheim bietet Frankreich den Betreibern 446 Millionen Euro. Der Stromkonzern ist auf das Angebot eingegangen.
Aktien der konkursiten Swissmetal werden am 16. März dekotiert – dann wird ein Verkauf erst recht schwierig.
Der italienische Schienennetzbetreiber RFI erhöht ab 2018 die Trassenpreise für internationale Züge stark. Das wird vor allem den Gütertransit durch die Schweiz treffen.
Nach dem von Donald Trump angekündigten Rückzug der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft hängt die Zukunft des Paktes am seidenen Faden.
Während die Deutsche Bank den Bonus für die obersten Chargen streichen will, können die Chefs von UBS und CS weiterhin mit hohen Erfolgszahlungen rechnen.
Ernteausfälle in Südeuropa sorgen für drastisch steigende Gemüsepreise. Leere Regale wird es dadurch trotzdem nicht geben.
Nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten starten die europäischen Börsen mit Minus in die Handelswoche. Auch der Schweizer Aktienmarkt notiert im Minus
Ob eine Politik der Wirtschaft Schub gibt oder nicht, sagt nichts über die langfristige Wirkung aus. Das zeigen die Geschichte und eine neue Studie.
Aus 40'000 Franken 6,4 Milliarden gemacht: Während General Electric in der Schweiz Stellen abbaut, ist dem US-Konzern mit seiner Tochterfirma ein Kunststück gelungen.
Der Elektronikkonzern legt einen Bericht zu den Problemen mit dem Note 7 vor.


























