
Mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen haben Wells Fargo, JP Morgan und Citigroup die Berichtssaison der Branche eröffnet.
Die wirtschaftliche Entwicklung seit der schweren Rezession gibt Rätsel auf. Fed-Chefin Yellen sagt, welche Fragen zu dessen Lösung beantwortet werden sollten.
Die Profitabilität des Vermögensverwaltungsgeschäfts, des Rückgrats der Schweizer Banken, nimmt ab. Daran dürfte in den nächsten Jahren kaum etwas ändern.
Wie hält es Deutschland mit dem Föderalismus? Bundesländer und Regierung haben sich zwar auf eine Reform der Finanzbeziehungen geeinigt – doch es ist eine vertane Chance.
Belgien kann möglicherweise dem Freihandelsabkommen der EU mit Kanada wegen des Widerstandes des frankofonen Landesteils nicht zustimmen. Dies würde das ganze Projekt gefährden. Was treibt die Wallonen zu dieser Haltung?
Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren fordert die Entlassung der SEC-Chefin. Diese weigere sich, Unternehmen zur Offenlegung ihrer Wahlkampfspenden zu zwingen.
Die Handelsabkommen der Schweiz bringen laut einem neuen Bericht eine deutliche Steigerung des Handelsvolumens. Handelsabkommen haben aber auch Nachteile – vor allem für die Unbeteiligten.
Der Bundesrat hat diese Woche die Kontingente für Spezialisten aus Drittstaaten leicht erhöht. Was dies für Schweizer Unternehmen, die auf Fachkräfte angewiesen sind, bedeutet.
Es ist gut, dass Ideen zu einem Staatsfonds für Risikokapital oder zu Anlagepflichten für Pensionskassen vorderhand vom Tisch sind. Dennoch kann der Staat einiges für Jungunternehmen tun.
Der Skandal um unrechtmässige Bankkonten und damit verbundene Gebühren hat für die Wells-Fargo-Führung einschneidende Folgen. Das könnte Schule machen.
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS ist nicht mehr staatlich dominiert. Schweden und Norwegen haben ihre Beteiligungen reduziert, nicht aber Dänemark. Dafür gibt es einen naheliegenden Grund.
Was bewegt Anleger dazu, dem hochverschuldeten italienischen Staat für 50 Jahre Geld zu leihen? Eine sagenhafte Verzinsung ist es schon einmal nicht.
Der Bundesrat erhöht die verfügbaren Arbeitsbewilligungen für Spezialisten aus aussereuropäischen Staaten nur leicht. Der halbherzige Schritt lässt viele Wünsche unerfüllt zurück.
Unwillkommene Begleiter der Energiewende sind die vielen traditionellen Versorger, die in der Schweiz nach Subventionen rufen. Ihr Ruf wird erhört, worauf sie weitere Ansprüche anmelden.
Fast alles ist in der Schweiz reglementiert. Hoffen lässt, dass es doch noch Berufe mit Freiraum gibt, etwa Journalismus oder Tätowieren. Letzterem macht aber ein Bundesamt das Leben schwer.
Immer mehr europäische Staaten führen Einschränkungen beim Bargeldverkehr ein. Ob es für Sparer sinnvoll ist, Bargeld zu horten, beantwortet Markus Linke, Vermögensverwalter bei Swisspartners, im Video-Interview.
Früher galt es als undenkbar, dass man dem Staat etwas dafür bezahlen muss, um ihm Geld zu leihen. Heute ist dies Realität. Wie Sparer damit umgehen sollten, erklärt Anlageexperte Stephan Meschenmoser.
Die Geldschwemme der Zentralbanken hat die Zinsen von sicheren Geldanlagen in der Schweiz unter null gedrückt. Wie Sparer am besten auf diesen Anlagenotstand reagieren, erklärt der Vermögensverwalter Damian Gliott im Video-Interview.
2017 sollen die Krankenkassenprämien wieder erhöht werden, je nach Kanton zwischen 3,5 und 7,3 Prozent. Ein Experte erklärt im Video-Interview, wie Versicherte ihre Kosten reduzieren können.
Die britische Wirtschaft muss sich nach dem Brexit auf harte Zeiten einstellen. Auch in Europa und in der Schweiz werden die Folgen zu spüren sein, wie Konjunkturforscher Jan-Egbert Sturm im Interview erklärt.
Die Ökonomin und Autorin Dambisa Moyo gibt einen besorgniserregenden Ausblick für die Weltwirtschaft. Im Video-Interview spricht sie über die Folgen dieser Entwicklung.
An überhitzten Finanzmärkten braucht es nicht viel, um für Nervosität zu sorgen. Vor allem dann, wenn der «monetäre Entzug» näherrückt.
Die SNB dürfte im dritten Quartal den Gewinn um mehrere Milliarden Franken gesteigert haben – dank dem höheren Aktienwert im Portfolio. Der Kursanstieg der SNB-Titel ist aussergewöhnlich.
Die Aktien von Immobiliengesellschaften zählen 2016 zu den wenigen Überfliegern. Seit Wochen sind die Kurse aber rückläufig. Die Korrektur könnte noch eine Weile anhalten.
Der Kurseinbruch der britischen Währung um gut sechs Prozent am Freitag hat überrascht, aber vielleicht muss man sich daran gewöhnen. Die Struktur des Devisenmarkts hat sich verändert.
Aktivistische Investoren haben schon Apple oder Dow Chemical zu Strategieänderungen getrieben. Kein Wunder, wollen auch Kleinanleger von der Gier dieser «Barbaren» profitieren.
Eine Velolampe gibt Auskunft darüber, wo das Strassennetz saniert werden muss – was nach Science-Fiction klingt, könnte bald möglich sein. Mehrere Milliarden Geräte sollen in den nächsten Jahren ans Netz angeschlossen werden. Wir erklären, wie das Internet der Dinge funktioniert.
Mit Optionen kann man auf steigende oder fallende Kurse wetten. Das Finanzinstrument kommt in verschiedenen Formen daher. Als Anleger gilt es, genau hinzuschauen.
Der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat Private Equity Fonds einst als Heuschrecken bezeichnet. Wir erklären, was sich hinter dem Begriff tatsächlich vebirgt.
Altbekannte Gegner wollen in einem «Tribunal» vom Unternehmen verursachte Schäden an Menschen und der Umwelt präsentieren. Es droht eine einseitige Veranstaltung.
Auf der Südinsel Kyushu läuft trotz Protesten der Ortsbevölkerung das Kernkraftwerk Sendai. Ein Besuch zeigt, dass die Zentralregierung mit Erfolg ihre Position durchsetzt.
Die durch den Brexit ausgelöst Pfund-Schwäche fordert erste Opfer. Der beliebte Brotaufstrich Marmite ist aus den Tesco-Regalen verschwunden. Inzwischen sollen sich Unilever und Tesco geeinigt haben.
Viele Italiener horten Bargeld zu Hause oder in Safes. Um die brachliegenden Milliarden in Umlauf zu bringen, erwägt die Regierung eine neue Amnestie für Steuerbetrüger.
Brasiliens politische Krise und die Rezession werden noch länger andauern. Doch strategische Investoren aus dem Ausland nutzen bereits den Zeitpunkt zum Einstieg.
Der Schweizer Markt für Risikokapital ist ausbaufähig. Neue Projekte wie der «Zukunftsfonds Schweiz» bringen Angebote für Pensionskassen. Eine Anlagepflicht für Pensionskassen soll es nicht geben.
Chinas Lohnniveau ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dennoch werden weiter Möbel, Schuhe, Kleider und Spielzeuge an der Ostküste das Landes produziert – zum Verdruss von Donald Trump.
Deutschland kann dem Handelsabkommen der EU mit Kanada nächste Woche zustimmen. Das Verfassungsgericht hat alle Eilanträge abgelehnt. Gleichzeitig hält es für Berlin aber einige Hausaufgaben bereit.
Die japanischen Autoriesen Toyota und Suzuki wollen zusammenarbeiten. Die Verflechtung der zwei Traditionsfirmen könnte gar noch stärker werden.
Die Bundesanwaltschaft leitet eine Strafuntersuchung gegen die Falcon Private Bank. Die Verdachtsmomente wiegen schwer.
Auch die Bundesanwaltschaft eröffnet jetzt ein Verfahren gegen die Zürcher Falcon Private Bank. Diese hat am Dienstag wegen Geldwäscherei und Verwicklung in den 1MDB-Skandal ihre Filiale in Singapur schliessen müssen.
Es ist ein Warnruf vom Genfersee. Die europäische Kundschaft bleibt aus. Dadurch sinken die verwalteten Vermögen. Was wollen die Bankiers dagegen unternehmen?
Im Umfeld von Wisekey ist von einer geopolitisch relevanten Technologie die Rede. Im Einsatz ist sie bereits milliardenfach. Passt das zum schlechten Börsenstart der kleinen Schweizer Firma?
Vom innovativen PC-Bastler zum Lenker des IT-Kolosses Dell-EMC: Während mehr als dreier Jahrzehnte prägte Michael Dell die Branche – und zeigt keine Anstalten, rasch wieder ins zweite Glied zu treten.
Samsung stellt die Produktion seines feuergefährlichen Galaxy Note 7 endgültig ein. Alle Geräte werden zurückgerufen. Der Fall ist ein bisher beispielloses Debakel im Smartphone-Geschäft.
Am Sonntag, 2. Oktober, jährt sich das Grounding der Swissair zum fünfzehnten Mal. Der Nationalstolz war nach der grössten Firmenpleite der Nachkriegszeit tief verletzt. Der Schock war auch heilsam.
Binnen fünf Jahren erreichte die Swissair ihr bestes und ihr schlechtestes Jahresergebnis. Verfolgen Sie Aufstieg und Fall der Airline in unserer Infografik – mit nur einem Knopfdruck.
Als im Herbst 2001 die Swissair zahlungsunfähig wurde und ihre Flugzeuge am Boden bleiben mussten, ging mehr als «nur» ein Unternehmen unter. Die Airline mit dem Schweizer Kreuz auf dem Leitwerk hatte jahrzehntelang als eine Art Image-Botschafter der Schweiz in aller Welt gegolten. Ein Rückblick auf sieben Jahrzehnte helvetische Aviatik-Geschichte in Bildern.
Eineinhalb Jahrzehnte nach dem Grounding der Swissair tragen noch immer etliche Firmenklubs deren Namen, und eine 2010 gegründete Ehemaligenvereinigung zählt bereits über 3200 Mitglieder.
Das Grounding vor fünfzehn Jahren war zweifellos ein wirtschaftliches Desaster. Es war aber auch der Höhepunkt des Streits im bürgerlichen Lager. Seither ist viel passiert – sind die Wunden verheilt?
So dokumentierten die Berichterstatter der NZZ die letzten Wochen der «fliegenden Bank» bis zu ihrem Untergang.
Den 2. Oktober 2001 verbinden Schweizer Aviatik-Fans und Nostalgiker mit einem Bild: der «gegroundeten» Swissair-Flotte am Flughafen Zürich. Das Nationalheiligtum blieb an diesem Tag am Boden. Die für ihre Verlässlichkeit gepriesene Airline sorgte für internationale Schlagzeilen. Das kratzte am Selbstverständnis der Schweiz.
Am 2. Oktober 2001 bleiben die Flugzeuge der Swissair am Boden. Das Ereignis geht als «Swissair-Grounding» in die Geschichte ein und sorgt in der Politik und Bevölkerung für grosse Emotionen. Ein Rückblick auf die Ereignisse in Bildern.
Das «Ökonomen-Einfluss-Ranking» der NZZ beschränkt sich auf den deutschsprachigen Raum. Würden auch Wirtschaftsforscher des Auslands berücksichtigt, tauchten bekannte Namen in der Rangliste auf.
Ernst Fehr hängt sie alle ab und setzt sich im gesamten deutschsprachigen Raum an die Spitze. Auf den nachfolgenden Rängen kommt es derweil zu gewichtigen Verschiebungen.
Die komplette Rangliste zählt 48 Ökonomen. Bei den einflussreichsten Institutionen steht die Universität Zürich an der Spitze, dicht darauf folgt die Universität St. Gallen.
Ernst Fehr ist der neue Star im deutschsprachigen Raum. Er führt die Ranglisten auch in den Nachbarländern an. Aus der Schweiz haben zwei weitere Ökonomen den Sprung über die Grenze geschafft.
Die Rangliste der einflussreichsten Ökonomen basiert auf den drei Teil-Rankings: Medien, Politik und Wissenschaft. Aufgenommen wird nur, wer sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Forschung wahrgenommen wird.
Die Durchleuchtung staatlicher Förderprogramme zeigt, dass Subventionen für privatwirtschaftliche Forschung und Entwicklung effektvoll sein können. Unklar bleibt, inwiefern dies zu Markterfolg führt.
Soll die EZB zum Mittel des «Helikopter-Geldes» greifen, um die Inflation anzukurbeln? Es darf bezweifelt werden, dass das Mittel gegen die chronische Nachfrageschwäche wirkt. Das Für und Wider von Helikoptergeld muss sorgsam abgewogen werden.
In Österreich scheinen Strukturprobleme nicht allzu gross zu sein. Es lässt sich viel mit der Konjunktur erklären. Probleme gibt es in der Bildung und im Hightech-Bereich.
Nepal zählt zu den ärmsten Ländern und ist auf Entwicklungshilfe angewiesen. Die Wirkung der ausländischen Unterstützung hängt auch vom Verhalten der Notenbank des Landes ab.
Die Flüchtlingspolitik steht vor zahlreichen Herausforderungen. Mit Charter Cities könnte Flüchtlingen geholfen werden, ohne dass deren Heimatregionen auf Dauer Arbeitskräfte verloren gehen.
Im Juni 2016 wurde der Mindestlohn in Deutschland angehoben. Bei dieser Entscheidung war die vorangehende Tarifentwicklung zentral. Künftige negative Nebeneffekte wurden ausgeblendet.
Der Harvard-Professor Dani Rodrik plädiert in seinem Buch über das Wohl und Wehe der Wirtschaftswissenschaften für weniger Überheblichkeit. Er lotet die Grenzen der Erklärungskraft von Modellen aus.
Die Uhrenbranche bekundet Mühe, effektiv auf neue technologische Herausforderungen und gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Die Gründe hierfür liegen in der Vergangenheit.
Hierarchien sind nicht nur veraltet, sondern auch hinderlich für den Erfolg einer Firma. Diese These vertritt der Psychologe und Firmenberater Felix Frei in seinem neuen Buch.
Ob Verwaltungsräte, Abteilungsleiter oder Politiker: Wer mit Geldanreizen menschliches Verhalten steuern will, kann in Fallen tappen. Sogar die Ökonomen haben dies bemerkt.
Salzwassserkrokodile wurden in Australien einst bist fast zur Ausrottung gejagt. Seit 40 Jahren stehen sie unter Schutz. Und tragen zur lokalen Wirtschaft bei.
Der Tsukiji-Fischmarkt in Tokio ist der grösste der Welt. Hier wechseln über 2000 Tonnen Fisch pro Tag den Besitzer. Was passiert da genau?
Port Hedland im Nordwesten Australiens ist der grösste Exporthafen für Schüttgut der Welt. 98 Prozent davon sind Eisenerz.
Grosse Teile der Mongolei sind ausgesprochen dünn besiedelt. Gleichzeitig wohnt die Hälfte der mongolischen Bevölkerung in der Hauptstadt Ulaanbaatar – und es werden immer mehr.
Deutsche Behörden haben diverse CD mit gestohlenen Bankdaten gekauft. Eine Hausdurchsuchung aufgrund solcher Daten sei rechtens gewesen, urteilt nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.
Das Bundesgericht ist zum Schluss gekommen, dass die Cornèr Bank keine Mitarbeiterdaten an die USA liefern darf. Der Schutz der Anonymität ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.
Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Tessiner Cornèr Bank abgelehnt. Diese darf die Namen von Anwälten nicht an die USA weiterleiten.
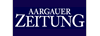
Amerikanische Touristen können künftig mehr Rum und Zigarren aus Kuba mitbringen. Die Regierung von Präsident Barack Obama hob am Freitag Beschränkungen auf, wonach die Obergrenze auf 100 US-Dollar festgelegt war.
In der kommenden Woche wollen die EU-Handelsminister beim Handelsabkommen EU-Kanada (Ceta) Fakten schaffen, die Zeit drängt. In Deutschland hat das deutsche Verfassungsgericht am Donnerstag grünes Licht für das Abkommen gegeben. Wie stehen die anderen EU-Länder zu dem Abkommen? Ein Überblick:
Die erste kräftige Föhnlage in diesem Herbst hat manchen Gipfeln am Freitag Orkanböen beschert. Auf dem Corvatsch im Engadin wurden 128 Kilometer pro Stunde gemessen. Im Berner Oberland musste die Jungfraubahn ihren Betrieb vorübergehend einstellen.
In manchen Quartieren der Stadt Genf werden bald Autos mit Scannern die Nummernschilder der parkierten Autos ablesen, um Parksünder rascher ausfindig zu machen. Andere Städte machten bereits gute Erfahrungen damit.
Die Migros ruft den Snack "Blévita Kürbiskernen Portion, lactosefrei" zurück. Obwohl das Produkt keine Milch enthalten darf, wurden in zwei Chargen Milchproteine nachgewiesen.
Der Verlag von Jürg Marquard expandiert in Ungarn. Die ungarische Oppositionszeitung "Nepszava" soll neu von der Marquard Media Gruppe herausgegeben werden. Die Angestellten bangen um ihren Job.
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann hat in Wien den "Inländervorrang light" verteidigt. "Wir sind der Ansicht, dass das eine personenfreizügigkeitsverträgliche Lösung ist", sagte Schneider-Ammann am Freitag.
Das Desaster beim Smartphone Galaxy Note 7 kommt Samsung immer teurer zu stehen. Der operative Gewinn wird in den beiden Quartalen bis Ende März um etwa 3,5 Billionen Won (3,05 Milliarden Franken) geringer ausfallen.
Der Berner Energiekonzern BKW stärkt sein Dienstleistungsgeschäft und übernimmt die deutsche IFB Eigenschenk Gruppe. Für die BKW ist es in Deutschland bereits die zweite Übernahme im Ingenieurbereich im laufenden Jahr.
Die chinesischen Chemiekonzerne Sinochem und ChemChina sondieren angeblich eine Fusion zu einem neuen Weltmarktführer. Treibende Kraft bei den Plänen in der Chemie-, Düngemittel- und Ölindustrie mit einem Jahresumsatz von fast 100 Milliarden Dollar sei der Staat.
Der Preiskampf zwischen der britischen Supermarktkette Tesco und dem Unilever-Konzern unter anderem um den beliebten Hefe-Brotaufstrich Marmite ist beendet. Unilever teilte mit, man sei erfreut, dass "geliebte Marken" wieder voll zur Verfügung stünden.
Die AKW-Betreiber wehren sich weiter gegen zusätzliche Zahlungen für die Stilllegung von Atomkraftwerken. Nachdem sie vor Bundesverwaltungsgericht abgeblitzt sind, haben sie erneut eine Beschwerde eingereicht.
Im Weinbau sei das laufende Jahr aussergewöhnlich schwierig gewesen, schreibt die Forschungsanstalt Agroscope. Die Pilzkrankheit "Falscher Rebenmehltau" habe teilweise zu grossen Ernteverlusten geführt. Einen derart starken Befall gab es seit 20 Jahren nicht mehr.
Die Aktien des Agrochemiekonzerns Syngenta sind am Freitag an der Börse unter Druck geraten nach einem Bericht über eine mögliche Fusion der beiden chinesischen Staatsfirmen ChemChina und Sinochem. Die Aktie büsste in einem festen Umfeld rund zwei Prozent an Wert ein.
Sony hat sein Headset für virtuelle Realität Playstation VR weltweit auf den Markt gebracht. Seit Donnerstagabend ist die Brille für Sonys Spielekonsole auch in Europa erhältlich.
Schweizerinnen und Schweizer haben eine positive Einstellung zum Unternehmertum. Geht es aber darum Nägel mit Köpfen zu machen, zögern viele.
Genf gibt sich ein neues Taxi-Gesetz, mit dem der Kanton Fahrdienste wie Uber legalisiert und reguliert. Uber-Fahrer müssen demnach einen Taxi-Führerausweis besitzen und eine Prüfung bestehen. Das Kantonsparlament hiess das Gesetz am Donnerstagabend deutlich gut.
Die Übernahme des angeschlagenen Internetriesen Yahoo durch den US-Telekom-Konzern Verizon droht ins Stocken zu geraten. Laut dem Verizon-Chefjuristen Crais Silliman ist davon auszugehen, dass der Datendiebstahl bei Yahoo die Bedingungen für den Deal verändert.
Samsung kostet das Debakel um sein Smartphone Galaxy Note 7 viel Geld. Doch die Rückrufkosten dürften nach Ansicht der US-Ratingagentur Fitch noch das kleinere Problem für den Smartphone-Marktführer sein. Laut Fitch droht Samsung ein langwieriger Imageschaden.
Das Debakel mit explodierenden Akkus trifft nicht nur Samsung: Lithium-Ionen-Akkus brachten schon Flugzeuge zum Absturz, weil sie sich spontan entzündeten. Eine Forschungsgruppe der ETH Zürich arbeitet an einem neuen, sicheren Akku-Design.


























