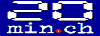
Die Apple Watch verkauft sich laut Marktforschern schlechter als erwartet. Trotzdem dürfte dies Apple kaum Sorgen bereiten.
Coop hat im Frühling den «Heftli-Streit» gewonnen und fordert wegen der Frankenstärke nun auch von Herstellern von Körperpflegeprodukten tiefere Preise.
Das Vertrauen in Chinas Wirtschaft sinkt. Experten warnen: «Das Schlimmste kommt noch.»
Zukunftsmusik für Hörbehinderte: Forscher in England entwickeln ein Hörgerät, das Lippen lesen kann. Die Vorarbeit hierfür leistete die ETH Zürich.
Getrübte Aussichten für Postfinance-Kunden: Die Post-Tochter senkt die Zinsen und verrechnet gleichzeitig höhere Gebühren. CEO Hansruedi Köng verteidigt das Vorgehen.
Die Migros will in Bayern 130 Filialen von Tengelmann kaufen. Das deutet auf einen Expansionskurs des Schweizer Detailhändlers hin.
Der Tesla S gilt als das coolste Auto der Welt. Es lässt nicht nur Elektronik-Nerds vor Neid erblassen. Neun Gründe, warum Tesla sich selbst überholt.
Handy-Apps und smarte Uhren erlauben es Eltern, ihre Kinder fast überall zu kontrollieren. Experten kritisieren die übetriebene Überwachung.
Nichtskönner und Besserwisser in Schweizer Teppichetagen: 20-Minuten-Leser erzählen von ihren Horror-Chefs. Ein Coach rät zum Handeln.
Nachdem die Reddit-Chefin Ellen Pao eine populäre Mitarbeiterin entlassen hatte, legten Mitglieder die Website lahm. Jetzt tritt sie zurück.
Ein neues Wort bereichert seit kurzem die Debatte um das verschuldete Griechenland. Erfunden hat es der Mann, der auch den Begriff Grexit kreierte.
Besorgt blickt die Schweizer Uhrenindustrie auf ihren wichtigsten Absatzmarkt China. Anleger dürften dort viel Geld verspekuliert haben. Das fehlt nun zum Kauf von Luxusgütern.
Wer heute eine Rechnung bezahlt, tut dies nicht mehr ausschliesslich am Monatsende. Dank Apps ist der Zugriff auf die eigenen Bankkonten so einfach und komfortabel wie nie zuvor.
Im März und April suchte PostFinance die ultimativen Alltagsvereinfacher. Nun hat die Jury entschieden, an welche Projekte das Preisgeld geht.

Die Euro-Staaten arbeiten an einem Angebot an Griechenland, das die Aufnahme von Verhandlungen über ein drittes Hilfsprogramm an griechische Vorleistungen und strikte Bedingungen knüpft.
Ein Verhandlungsmarathon in Brüssel sollte am Wochenende über die Zukunft Griechenlands und der Euro-Zone entscheiden. Nachfolgend eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse.
Die 19 Regierungschefs der Euro-Staaten beraten in Brüssel über eine Lösung in der Griechenland-Krise. Offenbar ist zumindest phasenweise die Atmosphäre äusserst gespannt.
Die Euro-Gruppe hat ihre Beratungen über die Griechenland-Hilfe nach den Marathonverhandlungen vom Samstag am Sonntag wieder aufgenommen. Ziel ist es, Empfehlungen zuhanden der Staats- und Regierungschefs zu formulieren. Noch sind die Differenzen aber gross.
Am 16. Juli 1995 verkaufte der Online-Händler Amazon sein erstes Buch via Internet und leitete damit eine Revolution des Detailhandels ein. Doch aus Amazons Sicht ist das erst der Anfang.
Die Krisenpolitik der EU zu Griechenland nimmt immer stärker Züge einer klassischen Tragödie an. Diese endet jeweils in einer Katastrophe.
Der Entwurf der Finanzminister der Euro-Gruppe für eine Vereinbarung mit Griechenland im Wortlaut, englisch (über die Passagen in eckigen Klammern bestand keine Einigkeit).
Die Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket für Griechenland gestalten sich schwierig. Die Euro-Gruppe hat sie nach neunstündiger Debatte um Mitternacht unterbrochen. Am Sonntag geht es weiter.
Mit ihrer neuen Reformliste negiert die griechische Regierung entweder den Wählerwillen, oder sie täuscht die Gläubiger. Letzteres erscheint als plausibler.
In einer wichtigen Rede geht die Fed-Vorsitzende kaum auf das turbulente internationale Umfeld ein. Das ist ein gutes Zeichen.
Tour-Operators planen bereits die Sommersaison von 2016. Gleich mehrere Mittelmeerländern sind in Gefahr, ausser Abschied und Traktanden zu fallen.
Die polnische Wirtschaft wächst robust. Anders als in Frankreich oder Russland blüht das Unternehmertum. Ein Warnsignal sind aber politische Vorschläge, wonach Banken zur Kasse gebeten werden sollen.
Das Basler Dental-Unternehmen Straumann hat viel Erfahrung mit Zukäufen. Doch auch bei ihm führte bisher nur jeder vierte bis fünfte Übernahmeversuch zum Ziel. Die Liste von Fallstricken ist lang.
Im Vermögensverwaltungsgeschäft sind Zukäufe von Geschäftsbereichen oder ganzen Instituten ein verlockender Weg, rasch zu wachsen. Aber das Risiko des Scheiterns ist gross.
Nach über 30 Jahren unterzieht sich der Hersteller von Computerzubehör einem Redesign. Es soll die umfangreichen internen Veränderungen spiegeln.
Wird Griechenland zahlungsunfähig oder verlässt es den Euro, kann es seine Euro-Kredite nicht mehr begleichen. Vor allem die grossen Staaten der Währungsunion müssen dann haften.
In Polen herrscht Wahlkampf. Die noch amtierende Regierung will den Inhabern teurer Franken-Hypotheken bei der Umwandlung in Zloty entgegenkommen. Die Opposition fordert zudem eine Bankensteuer.
Dieses Wochenende entscheidet über den Verbleib Griechenlands im Euro. Unmittelbar zuvor scheinen die Chancen einer Einigung wieder gestiegen zu sein. Dazu beigetragen hat die Reformliste.
Die unmittelbaren Kosten eines Zahlungsausfalls von Griechenland sind für die Schweiz überschaubar. Allerdings könnte gerade dies Begehrlichkeiten im europäischen Ausland wecken.
Die Royal Bank of Scotland (RBS) dampft laut Reuters-Informationen im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung ihr Geschäft in Griechenland ein.
Der Frankenschock hat anfänglich zwar auch Ems zugesetzt. Bei den operativen Erträgen ist der Währungseffekt jedoch bereits nicht mehr spürbar; die Margen haben im ersten Semester kräftig zugelegt.
Die Billigfluggesellschaft Ryanair stimmt dem Angebot der British-Airways-Mutter IAG zur Übernahme von Aer Lingus zu. Damit ist eine der letzten Hürden für die Transaktion aus dem Weg geräumt.
Der SMI ist mit einem deutlichen Plus ins Wochenende gegangen. Die Griechenland-Krise und das Auf und Ab an den Börsen in China sorgten auch hierzulande für deutliche Kursbewegungen.
Die Talfahrt an Chinas Börsen hat auf die Stimmung im Rohwarenmarkt gedrückt. Immerhin ist das Land der wichtigste Importeur von Rohstoffen wie etwa Eisenerz, Kohle und Baumwolle.
An den Finanzmärkten herrscht Zuversicht, dass es zu einer Lösung des Verhandlungsinfarkts zwischen Griechenland und seinen Gläubigern in letzter Minute kommt. Die Aktienmärkte liegen klar im Plus.
Der Ex-Informatiker und Datendieb der Bank Bär rechnet in Buchform mit der Bank und der Schweiz ab. Dichtung und Wahrheit sind aber stark vermischt.
William Green will den grössten Value-Investoren ein Denkmal setzen. Weil meist die Amerikaner dominieren, hat der Herausgeber auch Europäer porträtiert – darunter zwei Schweizer.
Die Beiträge in einem von Christopher und Rachel Coyne herausgegebenen Sammelband zeigen, dass Preiskontrollen ihrerseits einen Preis haben; die Folge sind meist dysfunktionale Korrekturmassnahmen.
Derzeit verharren die Zinsen auf tiefem Niveau, und die Aktien- und Immobilienmärkte erklimmen immer neue Höhen. Es stellt sich die Frage, wie diese Entwicklungen die Vermögensverteilung beeinflussen.
Liessen sich aus spieltheoretischer Sicht Streiks vermeiden? Die Theorie sagt Ja, die Praxis zeigt hingegen, dass sich insbesondere die Gewerkschaften dadurch profilieren können.
Der blosse Zugang zu Schulen hat sich nicht als ein effektives Entwicklungsziel erwiesen. Wichtig wäre, dafür zu sorgen, dass alle Jugendlichen mindestens ein Grundniveau an Kompetenzen erlangen.
Die einst als Dunkelkammern verschrienen Notenbanken sind von einer Transparenzwelle erfasst worden. Wie ist es bei der SNB um die Kommunikation bestellt?
Nach dem Schock über die Aufhebung des Euro-Mindestkurses sorgen die Negativzinsen für rote Köpfe. Strafzinsen wurden schon in den 1970er Jahren erhoben. Es gibt aber wichtige Unterschiede zu heute.
Sie kosten 30 Rappen pro Stück, sind bis zu 1000 Franken wert und gelten als Visitenkarte des Landes. Die Banknoten sind aber auch im Gespräch, weil die neue Serie seit Jahren auf sich warten lässt.
Neue Technologien versetzen Kunden in die Lage, jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus mit ihrer Bank zu interagieren. Unabhängig davon bleiben Berater unerlässlich.
Die Digitalisierung des Bankgeschäfts bedeutet keineswegs das Ende der Filialen. Diese können sich künftig noch stärker auf die individuelle Beratung der Kunden konzentrieren.
Swissquote-Chef Marc Bürki ist überzeugt davon, dass Universalbanken auch in einer digitalisierten Welt eine Zukunft haben – wenn sie ihre Geschäftsmodelle anpassen.
Lawrence H. Summers, ehemaliger US-Finanzminister, schätzt die Gefahr einer Auflösung der Eurozone als höher denn je ein. Europa stehe vor einer Phase niedrigen Wachstums, vergleichbar mit der Situation in Japan.
Was sind derzeit die grössten Risiken für Weltwirtschaft und Finanzmärkte? Antworten darauf lieferte eine Fragestunde mit Philipp Hildebrand und Axel Weber beim NZZ-Finanzforum in Bern.
Die Schweizer Banken müssen mehr tun. Zwar ist ihnen der Übergang in die Nach-Krisen-Ära gelungen. Aber sie kämpfen mit Defiziten in der Regulierung und im Umgang mit Kunden.
Die Notenbank kann Probleme lindern, aber nicht lösen. Um zu prosperieren, braucht die Schweizer Finanzbranche andere Rezepte.


























