
Der Bundesrat pocht auf ein möglichst unabhängiges Schiedsgericht. Zugleich bekräftigt er seine Zustimmung zu einem Kohäsionsbeitrag für die Teilnahme am EU-Binnenmarkt.
Wie der Bundesrat ist auch die EU bei den institutionellen Fragen für eine Schiedsgerichtslösung offen. Doch macht Brüssel zu viele Kompromisse, könnten die EU-Richter in Luxemburg auf die Barrikaden steigen.
Eine Zauberformel, welche alle Probleme für die Verhandlungen mit der EU löst, hat der Bundesrat nicht. Trotzdem: Er sollte das Zeitfenster nutzen, das sich nun bietet.
Wegen des Volks-Neins von 2017 zur Rentenvorlage werde die Neuauflage der Reform «teurer», sagt Sozialminister Alain Berset. Dem Volk wird damit einmal mehr Sand in die Augen gestreut.
Der Nationalrat fordert Massnahmen gegen die hohen Preise ausländischer Zeitschriften in der Schweiz. Dass die Preise hierzulande überhaupt so hoch sind, hat zwei verschiedene Gründe.
Nur zwei Linke unterstützen im Ständerat das Volksbegehren der Jungen Grünen.
Die bilateralen Beziehungen der Schweiz zur EU sind ein innen- und aussenpolitischer Dauerbrenner. Worum aber geht es beim institutionellen Rahmenabkommen, bei der Kohäsionsmilliarde, bei der Kündigungsinitiative? Und was hat die EU-Waffenrichtlinie mit alledem zu tun?
Für die CVP sieht es zunehmend düster aus, Grüne und FDP gewinnen dagegen in den kantonalen Parlamenten Sitze dazu. Eine Zwischenbilanz seit den eidgenössischen Wahlen.
Überraschend haben die Stimmberechtigten von Schwyz und Freiburg Juso-Initiativen zugestimmt, die mehr Licht in die Parteienfinanzierung bringen wollen. Bereitet das den Boden für die nationale Transparenzinitiative?
In einem knappen Entscheid sagt die Kleine Kammer Nein zu höheren Grenzwerten für Handyantennen. Damit wird den Telekommunikationsfirmen die Einführung des Mobilfunkstandards 5G erschwert.
Das Walliser Kantonsparlament steht hinter dem Projekt Olympischer Winterspiele «Sion 2026». Das Wallis will dafür 100 Millionen Franken lockermachen. Den definitiven Entscheid fällt das Stimmvolk am 10. Juni. Offene Fragen bleiben.
Der Reformdruck bei der SRG bleibt gross. Die Befürworter eines schlankeren audiovisuellen Service public könnten sich auch die geplante Einführung eines Gesetzes für elektronische Medien zunutze machen.
Der Zürcher Nationalrat Gregor Rutz will nach dem deutlichen Nein zu «No Billag» weiter für Gebührenreduktionen kämpfen. Statt ein neues Mediengesetz zu erlassen, will er den Fernseh- und Radiomarkt deregulieren.
Die «No Billag»-Initiative scheitert klar – und der Souverän schafft die wichtigste Einnahmequelle des Bundes nicht ab. Die wichtigsten Abstimmungen und Wahlen im Überblick.
Das Schweizer Stimmvolk entscheidet, ob es weiterhin Billag-Gebühren zahlen will zur Finanzierung von Radio und Fernsehen. Wo gehen die Billag-Gebühren hin? Wie funktioniert der SRG-Finanzausgleich? Eine Übersicht.
Nach einem intensiven Abstimmungskampf wurde «No Billag» deutlich abgelehnt. Inlandchef Michael Schoenenberger erklärt, was das bedeutet.
Die Begriffe Stadt und Land stehen für mentale Welten, die sich in den Agglomerationen überschneiden, aber trotzdem voneinander entfernen. Institutionen, die den nationalen Zusammenhalt auf ihre Fahne geschrieben haben, könnten Brückenbauer sein.
In ihrer Jugend huldigte Flavia Vasella dem Punk. Dann absolvierte sie die Jazzschule und fing an zu jodeln – und mit ihr viele andere.
Der Schrebergarten ist wieder in, und Städter kaufen Bauernhäuser auf dem Land. Der Volkskundler Thomas Hengartner erklärt, warum das so ist.
Der Palästinenser Abu Nidal war in den 1980er Jahren einer der meistgesuchten Terroristen. In dieser Zeit reiste er regelmässig unbehelligt in die Schweiz. Sein Fall beschäftigt nun die Schweizer Politik.
Von «Carlos» bis zu al-Kaida: Die Häufung von Verbindungen weltweit agierender Terroristen in die Schweiz ist frappant. Die Behörden scheuen bis heute eine Aufarbeitung.
Die Terrororganisation al-Kaida von Usama bin Ladin hatte überraschend enge Verbindungen in die Schweiz. Das geht unter anderem aus einem Protokoll hervor, das auf der Enthüllungs-Plattform Wikileaks aufgeschaltet worden ist. Es bestätigt das Bild, wonach die Schweiz in Sachen Terrorbekämpfung lange Zeit ein blinder Fleck war.
Als «grossartige Eigenleistung» wird er vor 50 Jahren angepriesen. Doch haarsträubende Mängel machen den Panzer 68 weltweit zum Gespött – Rückblick auf ein groteskes Kapitel der Schweizer Rüstungsgeschichte.
Mit einem Buch über den Oberbefehlshaber im Ersten Weltkrieg landet Niklaus Meienberg 1987 einen umstrittenen Knüller. Der Journalist rüttelt gekonnt an der Stellung der Mächtigen. Das zeigt sich auch an einem Streitgespräch in Zürich.
Die Militärdiktatoren in Argentinien wollen zur Nuklearmacht werden. Aus der internationalen Isolation hilft ihnen die Schweiz heraus – zum Ärger der USA. Ein Blick zurück.
Ausgerechnet das katholisch-konservative Nidwalden erlaubt im Oktober 1931 dem Schmied Niklaus Businger, seinen offiziellen Geschlechtseintrag zu ändern und fortan Margrit zu heissen. Ein Blick zurück auf eine europäische Pioniertat.
Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg finden 1948 wieder Olympische Spiele statt. Doch das Gezänk um Geld, der «Hockey-Krieg» und ideologische Verwerfungen trüben das grandiose Fest.
1958 wird in den Freibergen ein Refugium für Pferde eröffnet, die ihre Pflicht getan haben. Dem Projekt geht ein gehässiger Streit um Armeepferde voraus, und hinter ihm steht Hans Schwarz, ein streitbarer Pferdefreund und Journalist aus Bern.
Er ist ein schweizerisches Unikum: der Preisüberwacher. In der Bevölkerung äusserst beliebt, bleibt seine konjunkturpolitische Wirkung umstritten. Ein Blick zurück auf seine Entstehungsgeschichte.
Nach einem intensiven Abstimmungskampf wurde «No Billag» deutlich abgelehnt. Inlandchef Michael Schoenenberger erklärt, was das bedeutet.
1700 Stunden investierte Ernst Schefer ins Relief des Kantons Thurgau. Für sein aktuelles Projekt, das 7-Pässe-Relief, rechnet er mit rund 4000 Arbeitsstunden. Porträt eines Leidenschaftlichen.
In den neunziger Jahren kamen viele Kinder aus Kosovo in die Schweiz. Sie sind hier aufgewachsen, aber Kosovo lässt sie nicht los. Wie geht es ihnen heute?
Die Initiative «No Billag» wird vom Schweizer Stimmvolk mit über 71 Prozent Nein deutlich abgelehnt. Über 84 Prozent sagen Ja zur Finanzordnung 2021 des Bundes.
Die SP wollte am 3. März 1993 Christiane Brunner zur neuen Bundesrätin küren, die Bürgerlichen wollten nicht. Sie wählen Francis Matthey, der auf die Wahl verzichten musste. Der Weg für Ruth Dreifuss war frei.
In Bern läuft ein Grosseinsatz der Polizei: Nach einer Bombendrohung hat die Polizei das Gebiet um den Bahnhof abgeriegelt. Eine Person wurde festgenommen. In der Heiliggeistkirche hat die Polizei «verdächtige Gegenstände» gefunden.
Sechs Doppelstockzüge von Bombardier nehmen ihren Betrieb auf. Die erste Fahrt des «FV-Dosto» verläuft pannenfrei, doch noch bedarf es einiger Optimierungen.
Alain Berset macht Nägel mit Köpfen: Er will das Frauenrentenalter auf 65 Jahre angleichen und die Mehrwertsteuer um bis zu 1,7 Prozent erhöhen.
Frauen sollen laut den Vorschlägen der Regierung bis 65 Jahre arbeiten. Damit wären die Finanzen der AHV bis 2033 gesichert.
Das Nein zur Rentenreform bedroht das Vermögen des AHV-Ausgleichsfonds.
Die Zürcher Bundesparlamentarier politisieren mehrheitlich auf Fraktionslinie. Einige Ausreisser gibt es aber.
Wie positionieren sich die Fraktionen im Nationalrat auf der Links-rechts-Skala? Und wie hat sich das politische Spektrum der Parteien verändert? Das zeigt unser Parlamentarierrating 2017.
Pirmin Schwander ist der Rechtsausleger im Nationalrat, Lisa Mazzone die Linkste – und CVP-Fraktionschefin Viola Amherd die personifizierte Mitte. Die zentralen Erkenntnisse des Parlamentarier-Ratings im Überblick.
Der Freisinn profitiert von der Stärkung des rechten Lagers im Nationalrat – der SVP nützt ihr Wahlsieg von 2015 hingegen kaum. Für die Linke sind harte Zeiten angebrochen.
Die CVP zieht in der kleinen Kammer an einem Strick – dafür ist die SP weniger geschlossen als im Nationalrat. Daniel Jositsch ist auch im Stöckli der rechteste Sozialdemokrat.
Romands politisieren anders als Deutschschweizer, Nationalrätinnen anders als ihre männlichen Kollegen: Das zeigt das NZZ-Parlamentarier-Rating.
Einst haben die Zürcher Fahnenträger die nationale SVP auf strammen Rechtskurs getrieben. Die heutige Zürcher Delegation ist innerhalb der Fraktion ziemlich eingemittet. Dünner ist Zürich auch am rechten Flügel der SP vertreten.
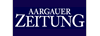
Seit bald 1100 Tagen steht Beznau I still – das soll sich Ende Monat offenbar ändern. Zumindest glaube das Grüne und AKW-Kritiker und wollen darum am Dienstag in Beznau dagegen protestieren, dass der Block 1 bald wieder in Betrieb geht.
Der Ständerat lehnt die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen ab. Er beschloss die Nein-Empfehlung am Montag mit 34 zu 2 Stimmen bei 9 Enthaltungen und verzichtete auf einen Gegenvorschlag. Auf Widerstand stiess das verlangte Einfrieren der Bauzonenfläche.
Der Nationalrat hat viele Fragen zu den Gewinnverschiebungen bei PostAuto. In der Fragestunde der grossen Kammer konnte Verkehrsministerin Doris Leuthard wegen der laufenden Verfahren am Montag kaum Antworten geben.
Die EU-Kommission hat verhalten positiv auf die von Aussenminister Ignazio Cassis präsentierte EU-Strategie der Schweiz reagiert. Auch in der Schweiz erhält der Bundesrat viel Zuspruch. Einzig die SVP fordert einmal mehr einen Marschhalt.
Berner Forscher finden immer mehr Hinweise darauf, dass der Komet Chury jünger sein könnte als bisher angenommen. So zeigen Computersimulationen, dass Chury nach einem heftigen Zusammenstoss grösserer Körper entstanden sein könnte.
Ein Reset ist es nicht. Aussenminister Ignazio Cassis nennt das Rahmenabkommen mit der EU über institutionelle Fragen zwar jetzt Marktzugangsabkommen. Den vor vier Jahren eingeschlagenen Kurs behält der Bundesrat aber bei. Hier können Sie die Medienkonferenz nochmals anschauen.
Nach dem Erdrutsch vom 13. Januar steht die Passstrasse am Forclaz im Wallis vor der Wiedereröffnung. Ab Mittwoch soll der Verkehr tagsüber wieder rollen. Nachts werden weitere Sicherungsarbeiten vorgenommen.
Wirbelstürme, Tsunamis und Dammbrüche sind selten aber meist zerstörerisch. Mit geeigneter Bauweise können die Auswirkungen von solchen Naturkatastrophen auf Gebäude stark eingedämmt werden, wie ein Lausanner Forscher zeigt.
Eine Staatsanwältin aus dem Kanton Zürich muss in einer Strafuntersuchung wegen Menschenhandels in den Ausstand treten. Sie hat diverse Verfahrensfehler begangen, die insgesamt schwerwiegend sind. Dies hat das Bundesgericht entschieden.
Mehr arbeiten wollen, aber nicht dürfen - in dieser ungemütlichen Lage stecken insbesondere teilzeitarbeitende Frauen. Einseitig von Arbeitgebern aufgezwungene Pensenreduktionen dienen in der Regel dazu, den Stellenbestand der Auftragslage anzupassen.
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) hat mit dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (Heks) eine Petition lanciert. Sie fordert, dass es sichere und legale Fluchtwege in die Schweiz geben soll. Zudem soll die Schweiz jährlich 10'000 Flüchtlinge aufnehmen.
«99 Sekunden» – die wichtigsten nationalen und internationalen Themen vom Morgen. Von Montag bis Freitag täglich.
Die «No Billag»-Initiative war Doris Leuthards letzter grosser Urnengang vor dem Rücktritt. Doch ausgerechnet während des Abstimmungskampfes braute sich so einiges zusammen.
Nach dem «No Billag»-Nein sieht SVP-Nationalrätin Natalie Rickli die Werbeeinschränkungen für die SRG kritisch. Sie will lieber die Gebühren senken, wie sie im Interview mit der «Nordwestschweiz» erklärt.
Die Gründe für die wuchtige Ablehnung von «No Billag», die Überhöhung der SRG und was jetzt wichtiger ist als eine Grundsatzdebatte über Service public. Ein Leitartikel von Rolf Cavalli.
Ein nächtlicher Brand hat eine Jagdhütte in Beringen SH am Sonntag komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr stand mit rund 30 Löschkräften im Einsatz.
Eine Bieridee hat die SRG Demut gelernt. Nun verbuchen die Initianten die Gebührensenkung als Erfolg für sich.
Nach dem deutlichen Nein zur «No Billag»-Initiative kommt SRG-Generaldirektor Gilles Marchand den privaten Verlegern entgegen. Dennoch sieht er sich weiterhin grossem Druck ausgesetzt.
Die GLP schafft erstmals den Einzug in die neunköpfige Zürcher Stadtregierung. Die Grünen konnten ihren zweiten Sitz zurückerobern und die FDP verteidigt ihren zweiten Sitz. Die CVP hingegen fällt aus der Regierung und die SVP schafft es wieder nicht.
Roger Schawinski denkt laut über die SRG nach. Seine Vorschläge sollen dem staatlichen Fernsehen die Zukunft sichern. Doch die SRG muss auch bei Schawinski um die Existenzberechtigung kämpfen.


























