
Die FDP wollte das Klimaziel reduzieren. Das wäre peinlich, meinte Bundesrätin Doris Leuthard. Regierungsräte, die den FDP-Antrag unterstützten, stellte sie als begriffsstutzig hin. Zu Unrecht.
Um das 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, setzt der Bund auf die Totalrevision das CO2-Gesetzes.
Ohne einschneidende Massnahmen ist das 2-Grad-Ziel nicht zu erreichen. Gerade die Schweiz sollte sich für den Klimavertrag von Paris starkmachen, da sie besonders stark vom Klimawandel betroffen ist.
Die vorberatende Kommission des Ständerats hält an ihrem Kompensationsmodell mit dem AHV-Zuschlag von 70 Franken fest. Mit zwei Kniffs werden die Kosten dieser Variante dem tieferen Niveau des Nationalrats angenähert.
Erstmals seit fünf Jahren besucht ein Nato-Generalsekretär die Schweiz. Diese profitiert von der Nato, ohne Mitglied zu sein. Trotzdem würde der Sicherheitsforscher Christian Nünlist von der ETH die Schweiz nicht als Trittbrettfahrerin bezeichnen.
Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist erstmals zu einem offiziellen Besuch in Bern empfangen worden. Künftig dürfte die Schweiz im Gebiet der Cyber-Sicherheit enger mit dem westlichen Verteidigungsbündnis kooperieren.
Die Post justiert die Reform ihres Netzes. An Orten ohne posteigene Filiale kann ab September Bargeld beim Pöstler einbezahlt werden, Agenturen werden grössere Massensendungen entgegennehmen, und Tageszeitungen sollen in jedem Fall bis 12 Uhr zugestellt werden.
Wie bei Autofahrern genügt künftig auch bei Bootsführern ein Atem-Alkoholtest, um einen zu hohen Pegel nachzuweisen. Das hat der Nationalrat am Donnerstag beschlossen. Heute ist eine Blutprobe nötig.
Viele Gemeinden müssen grosse Teile ihres Territoriums nach einer nationalen Gesetzesänderung zum gefährdeten Gebiet erklären. Im Berner Oberland hat dies zu einem Aufstand der Hausbesitzer geführt.
Gewisse Stimmen erachten ein Scheitern der Reform der Altersvorsorge im Vergleich zur Ausbauvorlage des Ständerats als kleineres Übel. Diese These hat etwas für sich.
Gespräche zwischen den Spitzen von CVP und FDP ergeben vorderhand nur einen minimalen Spielraum für einen Kompromiss. Die CVP will offenbar auf keinen Fall ihre Allianz mit der SP aufs Spiel setzen.
Fernbusse beginnen im internationalen Verkehr Lücken zu füllen, welche die Bahn geöffnet hat. Auch im Inland dürfte ihre Rolle im öffentlichen Verkehr komplementär sein.
Im öffentlichen Fernverkehr der Schweiz deuten mehrere Zeichen auf einen Übergang vom Monopol zum Wettbewerb. Doch das bestehende Regelwerk ist dazu nicht geeignet. Eine politische Diskussion tut not.
Seit 31 Jahren zieht der Tessiner Rudy Canonica mit Hunderten Schafen durch die Wintermonate. Er ist einer von vier Hirten im Kanton Bern. Ein Beruf, in dem es keine freien Tage gibt, dafür viele kalte Stunden.
Es genügt nicht, mit dem Wegzug von Konzernen zu drohen. Doch der internationale Druck auf die Schweiz wird bleiben. Nun muss rasch eine neue Vorlage kommen.
Für die anstehende Ski-WM hat sich St. Moritz kräftig herausgeputzt: Der renovierte Eispavillon ist eröffnet, und ein überdimensionierter Skifahrer thront über dem Dorfplatz. Doch die touristische Zukunft des Luxusorts ist ungewiss.
Die Beschäftigung im öffentlichen Sektor hat in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Ihr Wachstum ist aber nicht die grösste Bedrohung für den Staatshaushalt.
Die Ausgaben für Gesundheit und Bildung wachsen weiter, der Personalbestand in diesen Sektoren nimmt zu. Die Herausforderung besteht darin, gut ausgebildetes Personal zu finden.
Angesichts knapper Finanzen kommt auch das Bildungssystem unter Druck: Wieso etwa steigt die Zahl der Beschäftigten in Erziehung und Unterricht immer weiter, obwohl die Schülerzahlen gesunken sind?
Das Parlament wollte das Bundespersonal auf 35 000 Stellen begrenzen. Doch bei der Umsetzung dieses Entscheids hat sich der Bundesrat ein paar Hintertüren offengelassen.
Nicht nur im Gesundheits- und Sozialwesen dehnt sich der staatsnahe Sektor stark aus, sondern auch die öffentliche Verwaltung wächst. Gleichzeitig sinkt – anders als im privaten Sektor – die Produktivität. Ökonomen sind besorgt.
Trotz Masshalten steigt die Zahl kantonaler Angestellter weiter. Diese sehen sich Nullrunden bei den Löhnen und neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung ausgesetzt.
Verlässliche Daten über die Personalentwicklung in den 26 kantonalen Verwaltungen gibt es nicht. Jeder Kanton tickt anders, auch verändern sich die Grundlagen der Datenerhebung.
Was hat die Schweiz damals nur geritten? Im Kalten Krieg streitet sie monatelang über die Notwendigkeit von Militärpferden.
Punk in Wolfenschiessen, ein Schwingfest für Künstler im Garten eines Skistars: In den 1980er Jahren machen spätere Kulturgrössen wie Stephan Eicher ihre ersten Gehversuche.
Der Kriegsverbrecher Josef Mengele nutzte die Schweiz zeitweise als Stützpunkt für Kontakte mit seiner Familie in Günzburg. Gefasst wurde er dennoch nicht.
Nigerias Krieg gegen das abtrünnige Biafra weckt in der Schweiz Emotionen und Hilfsbereitschaft. Die humanitären Aktionen werden zum Lehrstück.
Nach einer wilden Schiesserei auf Grenzwächter wird der berüchtigten deutschen Linksterroristin Gabriele Kröcher-Tiedemann der Prozess gemacht. Ihr Leben endet tragisch – trotz Läuterung.
Südafrikas Apartheidregime sah sich Mitte der achtziger Jahre endgültig in die Ecke gedrängt. Unangenehm wurde es aber langsam auch für die Schweiz, die mit ihm vergleichsweise freundlich verkehrte.
1946 wurden bei Schweizer Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg gravierende Baumängel entdeckt. Die dafür verantwortlichen Militärs und Baufirmen kamen fast ungeschoren davon.
Weil die deutsche Wehrmacht plant, die Bodenseeflotte vor der Ankunft der Alliierten zu versenken, sorgt ein Beamter der Reichsbahn dafür, dass elf Schiffe nächtens in die Schweiz übersetzen.
Der sagenhafte Teufelsstein von Göschenen steht dem Bau des Gotthard-Strassentunnels im Weg und soll daher gesprengt werden. Doch die Urner opponieren und retten 1973 den Klotz – nicht zum ersten Mal.
Mit der Verhaftung von Raphael Huber begann vor 25 Jahren die Zürcher Wirte-Affäre. Die Justizposse ist auch ein Abbild der streng regulierten Zürcher Gastroszene der 1980er Jahre.
Neue Recherchen der NZZ zeigen: Ein Schweizer Nazi und ein militanter Palästinenser sollen beim Geheimdeal zwischen der Schweiz und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) von 1970 wichtige Rollen spielen. Von offizieller Seite wird das mündliche Abkommen verneint.
Der überprüfbare Inhalt eines bis dahin unbekannten FBI-Dokuments decke sich mit seiner langjährigen Forschung – deshalb erachtet es der deutsche Terrorexperte Wolfgang Kraushaar für glaubhaft.
Ein FBI-Bericht lässt den Bombenanschlag von 1970 auf ein Swissair-Flugzeug in neuem Licht erscheinen: In der palästinensischen Terrorgruppe sollen auch zwei Westdeutsche aktiv mitgewirkt haben.
Laut einem Untersuchungsbericht finden sich in den Akten der Bundesanwaltschaft keine Hinweise, dass das Strafverfahren zum Würenlingen-Attentat von 1970 nicht gesetzmässig durchgeführt worden ist.
Vertiefte Recherchen der Verwaltung bringen keine Hinweise auf ein Geheimabkommen. Die Geschäftsprüfer vertrauen darauf. Derweil untersuchen sie die Sistierung des Lenkwaffenprojekts Bodluv.
Als 20-Jähriger lauschte er im Sommer 1970 höchst vertraulichen Gesprächen zwischen seinem Vater und Bundesrat Pierre Graber: François A. Bernaths Erinnerungen bergen Zündstoff.
Der Bericht der behördlichen Arbeitsgruppe zur Causa Graber/PLO ist als Zwischenbilanz nützlich. Er kann aber nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachtet werden.
Wenn das Schweizer Volk Ja sagt zur erleichterten Einbürgerung, könnten Vincenzo und Diandra Schweizer werden. Als Kampagnenmaterial für die Befürworter taugen sie nicht.
Spitalseelsorgende haben stets ein offenes Ohr für Patienten und Angehörige – ein Besuch in Chur.
Was machen eigentlich die da oben in Bern, wenn sie sich gesetzgebend versammeln? Allerhand, wie flüchtige Eindrücke eines langen Sessionstags zeigen.
Pirmin Schwander ist der Rechtsausleger im Nationalrat, Lisa Mazzone die Linkste – und CVP-Fraktionschefin Viola Amherd die personifizierte Mitte. Die zentralen Erkenntnisse des Parlamentarier-Ratings im Überblick.
Der Freisinn profitiert von der Stärkung des rechten Lagers im Nationalrat – der SVP nützt ihr Wahlsieg von 2015 hingegen kaum. Für die Linke sind harte Zeiten angebrochen.
Die CVP zieht in der kleinen Kammer an einem Strick – dafür ist die SP weniger geschlossen als im Nationalrat. Daniel Jositsch ist auch im Stöckli der rechteste Sozialdemokrat.
Romands politisieren anders als Deutschschweizer, Nationalrätinnen anders als ihre männlichen Kollegen: Das zeigt das NZZ-Parlamentarier-Rating.
Einst haben die Zürcher Fahnenträger die nationale SVP auf strammen Rechtskurs getrieben. Die heutige Zürcher Delegation ist innerhalb der Fraktion ziemlich eingemittet. Dünner ist Zürich auch am rechten Flügel der SP vertreten.
Die erstarkende SVP zieht den Parlamentsschnitt nach rechts. Die SP wird immer linker. Die Grünen pendeln an den Rand und zurück. Zwei Jahrzehnte Nationalrat im Überblick.
Der 1954 in Basel geborene Bruno Manser setzte sich seit den 1980er Jahren für den Schutz des Urwaldes und der von ihm abhängigen Urbevölkerung ein – insbesondere für die in Sarawak, dem malaysischen Teil Borneos lebenden Penan. Seit 2005 gilt Manser als amtlich verschollen.
Niederschlagsarmut und Trockenheit führen dazu, dass die Wasserstände und Abflüsse auf teilweise stark unterdurchschnittliches Niveau sanken. Die Pegel der Seen und Flüsse befinden sich schweizweit auf neuen Tiefstständen.
Protektionismus macht die kleine Schweiz zur Produktionsstätte von Autos grosser Marken. 1934 wird in Arbon der erste «Amerikaner» zusammengesetzt, 1975 läuft in Biel der letzte Opel vom Band.
Der Nationalrat hat am Dienstag unverändert an seinen Positionen festgehalten. Ein Überblick über die wichtigsten Differenzen zum Ständerat.
Die Erhöhung des Rentenalters ist unumgänglich. Das Parlament muss dem Volk reinen Wein einschenken und die Debatte aufnehmen. Angst vor den Wählern steht Politikern hingegen schlecht an.
Mit der «Altersvorsorge 2020» steht wohl einiges mehr auf dem Spiel als bei der Unternehmenssteuerreform. Vor allem in der AHV drohen Defizite in Milliardenhöhe.
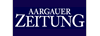
Ein Ex-Waffenhändler aus Unterseen BE, bei dem die Polizei 2014 etwa 2500 Waffen beschlagnahmt hat, ist am Donnerstag vor einem Gericht weitgehend abgeblitzt. Er wehrte sich dort gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft.
Die Sonderdebatte im Berner Stadtparlament zu den Krawallen der letzten Tage ist mit einem Eklat zu Ende gegangen: Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) durfte sich nicht zu den Polizei-Einsätzen am Mittwoch, Freitag und Samstag vergangener Woche äussern.
Die Waadtländer Kantonspolizei hat am Mittwoch in einem Haus in Vallorbe (VD) eine Hanfplantage ausgehoben. Ausserdem beschlagnahmte sie bei dieser Gelegenheit rund 70 Reptilien, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Die Reform der Altersvorsorge kommt nicht vom Fleck. Wie erwartet bleibt die Sozialkommission des Ständerats (SGK) in den wesentlichen Punkten unnachgiebig. Das Patt wird wohl erst in der Nachspielzeit aufgelöst.
Der Churer Bischofssprecher Giuseppe Gracia hat Erklärungsbedarf. Der Medienmann von Bischof Vitus Huonder bediente im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal im Kapuzinerorden aus dem Hintergrund Medienleute mit Informationen - und flog prompt auf.
Wo die Post nur noch Partnerfilialen betreibt, können Kunden ihre Rechnungen beim Pöstler mit Bargeld bezahlen. Mit solchen Massnahmen will die Post die geplante Schliessung von rund 600 Filialen auffangen. Welche Postschalter geschlossen werden, bleibt ungewiss.
Die Schweiz soll sich am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen. Der Nationalrat hat am Donnerstag das Pariser Abkommen genehmigt. Umstritten war, wie stark die Schweiz den CO2-Ausstoss reduzieren soll. Gegen das Abkommen stellte sich einzig die SVP.
Ein Mann aus dem Toggenburg ist definitiv zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden, weil er mit einem geladenen Revolver auf Kühe gezielt hat, die sich wiederholt am Rand seines Gartens verköstigt haben. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde abgewiesen.
Adi Flück gehört zu einer raren Spezies. Noch 400 Berufsleute weltweit beherrschen das Handwerk des Plattenschneidens. Vom Aussterben bedroht ist er trotzdem nicht: Musiker wie Yello, Züri West oder Fai Baba nehmen bei ihm Schallplatten auf.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist erstmals zu einem offiziellen Besuch in Bern empfangen worden. Künftig dürfte die Schweiz im Gebiet der Cyber-Sicherheit enger mit dem westlichen Verteidigungsbündnis kooperieren.
Verhaltensauffällige oder Schäden verursachende Wölfe sollen in der Schweiz raschmöglichst geschossen werden können. Die Bündner Regierung fordert den Bund auf, das eidgenössiche Jagdgesetz umgehend zu revidieren, damit eine Wolfsregulierung möglich wird.
Der LHC-Teilchenbeschleuniger des CERN steht nach der Winterpause kurz vor seinem Frühlingserwachen. Vorher steht noch ein wichtiger Schritt an: Ingenieure und Physikerinnen ersetzen das Herzstück eines der grossen Teilchendetektoren.
Die Grünliberale Partei fällt durch eigenständige Ideen auf. Während Präsident Martin Bäumle kürzertritt, melden sich immer mehr junge Politikerinnen und Politiker.
Wie Lobbyisten das Parlament dazu brachten, Teile des Internets abzuriegeln – ein Schmierentheater in sieben Akten.
Woher stammt die Pfütze, auf der Alt-Bundesrat Christoph Blocher ausgerutscht ist und sich die Nase gebrochen hat?
Nicht zugelassene Online-Geldspiele sollen in der Schweiz gesperrt werden. Nur Casinos mit Sitz in der Schweiz sollen diese anbieten dürfen.
Das Ringen um einen Kompromiss geht weiter. SVP-Ständerat Alex Kuprecht will die 70-Franken-Frage mit einem neuen Vorschlag knacken.
Der Winter 2016/2017 war im Mittelland zu kalt und zu trocken. In Zürich-Affoltern betrug das Temperaturdefizit im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 minus 0.6 Grad.
Für das Referendum gegen die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) wird es eng. Rund einen Monat vor Ende der Sammelfrist sind erst 12'000 von 50'000 notwendigen Unterschriften beisammen, wie die Verantwortlichen am Mittwoch in Bern bekanntgaben.
Alt-Bundesrat Christoph Blocher hat sich am Dienstagabend nach einem Sturz die Nase mehrfach gebrochen. Er wurde noch in der Nacht operiert, konnte das Spital aber bereits wieder verlassen.


























