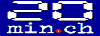
In Deutschland und Frankreich wütet ein heimtückischer neuer Norovirus-Typ. Das BAG schliesst nicht aus, dass der Typ auch in der Schweiz auftreten wird.
Mehrere Fasnachtskostüme für Kinder wurden vom Markt genommen - wegen Sicherheitsmängeln.
Unfälle von Kindern auf dem Spielplatz häufen sich. Experten streiten sich, ob Eltern zu intensiv oder zu wenig aufmerksam betreuen.
Das Fasnachtskomitee hat in Bassersdorf auf Strassentafeln Schilder mit Vereinsnamen angebracht. Damit reagiert es auf die Beschwerde eines Anwohners.
Noch nie wurde ein Schweizer Häftling nach Kosovo überstellt. Grund: Die Kantone haben Sicherheitsbedenken. Das sorgt beim Bund aber für Kopfschütteln.
Die physische und psychische Gewalt gegen Polizisten steigt, der Respekt nimmt ab. Ein betroffener Beamter erzählt.
Rote Sohlen als Markenzeichen: Im Gegensatz zu anderen Ländern lässt das Bundesgericht die Argumente des Herstellers von Luxusschuhen nicht gelten.
Oberwil-Lieli hat gegen die Zuweisung von zehn Flüchtlingen Beschwerde eingelegt. Denn für sechs Asylbewerber müssen trotzdem Ersatzzahlungen folgen.
Ein Genfer Kioskbesitzer wurde Opfer eines Raubüberfalls. Obwohl die Polizei den Täter festgenommen hat, will er ihn aus Sympathie nicht anzeigen.
Der Stuttgarter Christian R. bretterte mit 200 km/h durch den Gotthard. Nun muss er ein Jahr in den Knast. Doch das Urteil interessiert den 40-Jährigen nicht.
Stefan Meierhans will nicht nur Online-Buchungsplattformen genauer unter die Lupe nehmen. Ein Schwerpunkt sind zudem auch die Gesundheitskosten.
In der Nacht wurde ein 20-Jähriger auf dem Gleis bei Bellinzona getötet. Kurz darauf kam es im Bahnhof zu schockierenden Szenen.
Statt sich für den Rest des Lebens vegan zu ernähren, entscheiden sich viele Schweizer für einen Probemonat - und geben schnell wieder auf.
Legales Gras ist schwierig von illegalem zu unterscheiden. Nun sollen Schnelltests die Polizeiarbeit erleichtern.

Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet voran. Preisüberwacher Stefan Meierhans erklärt im Interview mit der NZZ, welche neuen Probleme und Fragestellungen sich daraus ergeben.
Wie gross ist der Einfluss von Lobbyisten in Bern tatsächlich? Um dies zu klären, ist kaum etwas geschehen. Auch dem Versuch, ein Akkreditierungssystems für Interessenvertreter zu schaffen, droht nun wieder ein Schiffbruch.
Es geht um einen vertuschten Missbrauchsskandal bei den Kapuzinern, angeblich manipulierte Medien und die Wirren um die Nachfolge im Bistum Chur: Der neuste Skandal zieht immer weitere Kreise.
Die Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli will keine Flüchtlinge aufnehmen. Deshalb hatte sie vergangenen Juli beim Kanton eine Beschwerde gegen die Zuweisung eingereicht - vorerst erfolglos.
Der Schuhdesigner Christian Louboutin erhält für seine rot besohlten hochhackigen Damenschuhe keinen Markenschutz in der Schweiz. Das Bundesgericht hält die rote Sohle nicht für aussergewöhnlich.
Nach dem Nein zur Unternehmenssteuerreform III haben sich die Finanzdirektoren am Freitag zu einer ersten Aussprache getroffen. Konkrete Vorschläge sind dabei nicht herausgekommen.
Die Beschäftigung im öffentlichen Sektor hat in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Ihr Wachstum ist aber nicht die grösste Bedrohung für den Staatshaushalt.
Die Bruttoschulden sind erstmals seit Jahren wieder unter 100 Milliarden Franken gesunken. Jetzt drängt der Bundesrat auf eine Lockerung der Schulden. Das Finanzdepartement aber zögert.
Gegen die Buchungsplattform Booking.com ist bereits eine Untersuchung hängig. Auch die steigenden Gesundheitskosten hat Stefan Meierhans im Visier.
Bei einer Hausräumung wurden diese Woche Polizisten verletzt. Seit Monaten fordert die Polizistengewerkschaft härtere Strafen bei Gewalt gegen Ordnungshüter. Nun beschäftigt sich die Politik mit dem Thema.
In der Nordwestschweiz soll im Jahr 2027 eine Landesausstellung stattfinden. Dieser Idee wollen Aargauer Politiker und Wirtschaftsvertreter zum Durchbruch verhelfen. Auch SP-Ständerätin Pascale Bruderer setzt sich ein.
Ein Tag nach der polizeilichen Räumung eines besetzen Hauses in Bern nimmt Stadtpräsident Alec von Graffenried im Interview mit der NZZ Stellung. Er bedauert die Eskalation.
Ist das internationale Abkommen gegen Gewalt an Frauen so harmlos, wie der Bundesrat behauptet? Eine bürgerliche Minderheit im Ständerat findet das nicht – und spricht ein grundsätzliches Problem an.
Seit 31 Jahren zieht der Tessiner Rudy Canonica mit Hunderten Schafen durch die Wintermonate. Er ist einer von vier Hirten im Kanton Bern. Ein Beruf, in dem es keine freien Tage gibt, dafür viele kalte Stunden.
Es genügt nicht, mit dem Wegzug von Konzernen zu drohen. Doch der internationale Druck auf die Schweiz wird bleiben. Nun muss rasch eine neue Vorlage kommen.
Für die anstehende Ski-WM hat sich St. Moritz kräftig herausgeputzt: Der renovierte Eispavillon ist eröffnet, und ein überdimensionierter Skifahrer thront über dem Dorfplatz. Doch die touristische Zukunft des Luxusorts ist ungewiss.
Die Ausgaben für Gesundheit und Bildung wachsen weiter, der Personalbestand in diesen Sektoren nimmt zu. Die Herausforderung besteht darin, gut ausgebildetes Personal zu finden.
Angesichts knapper Finanzen kommt auch das Bildungssystem unter Druck: Wieso etwa steigt die Zahl der Beschäftigten in Erziehung und Unterricht immer weiter, obwohl die Schülerzahlen gesunken sind?
Das Parlament wollte das Bundespersonal auf 35 000 Stellen begrenzen. Doch bei der Umsetzung dieses Entscheids hat sich der Bundesrat ein paar Hintertüren offengelassen.
Nicht nur im Gesundheits- und Sozialwesen dehnt sich der staatsnahe Sektor stark aus, sondern auch die öffentliche Verwaltung wächst. Gleichzeitig sinkt – anders als im privaten Sektor – die Produktivität. Ökonomen sind besorgt.
Trotz Masshalten steigt die Zahl kantonaler Angestellter weiter. Diese sehen sich Nullrunden bei den Löhnen und neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung ausgesetzt.
Verlässliche Daten über die Personalentwicklung in den 26 kantonalen Verwaltungen gibt es nicht. Jeder Kanton tickt anders, auch verändern sich die Grundlagen der Datenerhebung.
Punk in Wolfenschiessen, ein Schwingfest für Künstler im Garten eines Skistars: In den 1980er Jahren machen spätere Kulturgrössen wie Stephan Eicher ihre ersten Gehversuche.
Der Kriegsverbrecher Josef Mengele nutzte die Schweiz zeitweise als Stützpunkt für Kontakte mit seiner Familie in Günzburg. Gefasst wurde er dennoch nicht.
Nigerias Krieg gegen das abtrünnige Biafra weckt in der Schweiz Emotionen und Hilfsbereitschaft. Die humanitären Aktionen werden zum Lehrstück.
Nach einer wilden Schiesserei auf Grenzwächter wird der berüchtigten deutschen Linksterroristin Gabriele Kröcher-Tiedemann der Prozess gemacht. Ihr Leben endet tragisch – trotz Läuterung.
Südafrikas Apartheidregime sah sich Mitte der achtziger Jahre endgültig in die Ecke gedrängt. Unangenehm wurde es aber langsam auch für die Schweiz, die mit ihm vergleichsweise freundlich verkehrte.
1946 wurden bei Schweizer Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg gravierende Baumängel entdeckt. Die dafür verantwortlichen Militärs und Baufirmen kamen fast ungeschoren davon.
Weil die deutsche Wehrmacht plant, die Bodenseeflotte vor der Ankunft der Alliierten zu versenken, sorgt ein Beamter der Reichsbahn dafür, dass elf Schiffe nächtens in die Schweiz übersetzen.
Der sagenhafte Teufelsstein von Göschenen steht dem Bau des Gotthard-Strassentunnels im Weg und soll daher gesprengt werden. Doch die Urner opponieren und retten 1973 den Klotz – nicht zum ersten Mal.
Mit der Verhaftung von Raphael Huber begann vor 25 Jahren die Zürcher Wirte-Affäre. Die Justizposse ist auch ein Abbild der streng regulierten Zürcher Gastroszene der 1980er Jahre.
Im Spätherbst 1907 feiern die Urkantone und Studenten 600 Jahre Eidgenossenschaft. Obwohl das Datum stark umstritten ist, markiert der Bundesrat mit einer hochkarätigen Delegation Präsenz in der Innerschweiz.
Neue Recherchen der NZZ zeigen: Ein Schweizer Nazi und ein militanter Palästinenser sollen beim Geheimdeal zwischen der Schweiz und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) von 1970 wichtige Rollen spielen. Von offizieller Seite wird das mündliche Abkommen verneint.
Der überprüfbare Inhalt eines bis dahin unbekannten FBI-Dokuments decke sich mit seiner langjährigen Forschung – deshalb erachtet es der deutsche Terrorexperte Wolfgang Kraushaar für glaubhaft.
Ein FBI-Bericht lässt den Bombenanschlag von 1970 auf ein Swissair-Flugzeug in neuem Licht erscheinen: In der palästinensischen Terrorgruppe sollen auch zwei Westdeutsche aktiv mitgewirkt haben.
Laut einem Untersuchungsbericht finden sich in den Akten der Bundesanwaltschaft keine Hinweise, dass das Strafverfahren zum Würenlingen-Attentat von 1970 nicht gesetzmässig durchgeführt worden ist.
Vertiefte Recherchen der Verwaltung bringen keine Hinweise auf ein Geheimabkommen. Die Geschäftsprüfer vertrauen darauf. Derweil untersuchen sie die Sistierung des Lenkwaffenprojekts Bodluv.
Als 20-Jähriger lauschte er im Sommer 1970 höchst vertraulichen Gesprächen zwischen seinem Vater und Bundesrat Pierre Graber: François A. Bernaths Erinnerungen bergen Zündstoff.
Der Bericht der behördlichen Arbeitsgruppe zur Causa Graber/PLO ist als Zwischenbilanz nützlich. Er kann aber nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachtet werden.
Wenn das Schweizer Volk Ja sagt zur erleichterten Einbürgerung, könnten Vincenzo und Diandra Schweizer werden. Als Kampagnenmaterial für die Befürworter taugen sie nicht.
Spitalseelsorgende haben stets ein offenes Ohr für Patienten und Angehörige – ein Besuch in Chur.
Was machen eigentlich die da oben in Bern, wenn sie sich gesetzgebend versammeln? Allerhand, wie flüchtige Eindrücke eines langen Sessionstags zeigen.
Pirmin Schwander ist der Rechtsausleger im Nationalrat, Lisa Mazzone die Linkste – und CVP-Fraktionschefin Viola Amherd die personifizierte Mitte. Die zentralen Erkenntnisse des Parlamentarier-Ratings im Überblick.
Der Freisinn profitiert von der Stärkung des rechten Lagers im Nationalrat – der SVP nützt ihr Wahlsieg von 2015 hingegen kaum. Für die Linke sind harte Zeiten angebrochen.
Die CVP zieht in der kleinen Kammer an einem Strick – dafür ist die SP weniger geschlossen als im Nationalrat. Daniel Jositsch ist auch im Stöckli der rechteste Sozialdemokrat.
Romands politisieren anders als Deutschschweizer, Nationalrätinnen anders als ihre männlichen Kollegen: Das zeigt das NZZ-Parlamentarier-Rating.
Einst haben die Zürcher Fahnenträger die nationale SVP auf strammen Rechtskurs getrieben. Die heutige Zürcher Delegation ist innerhalb der Fraktion ziemlich eingemittet. Dünner ist Zürich auch am rechten Flügel der SP vertreten.
Die erstarkende SVP zieht den Parlamentsschnitt nach rechts. Die SP wird immer linker. Die Grünen pendeln an den Rand und zurück. Zwei Jahrzehnte Nationalrat im Überblick.
Niederschlagsarmut und Trockenheit führen dazu, dass die Wasserstände und Abflüsse auf teilweise stark unterdurchschnittliches Niveau sanken. Die Pegel der Seen und Flüsse befinden sich schweizweit auf neuen Tiefstständen.
Protektionismus macht die kleine Schweiz zur Produktionsstätte von Autos grosser Marken. 1934 wird in Arbon der erste «Amerikaner» zusammengesetzt, 1975 läuft in Biel der letzte Opel vom Band.
Bundespräsidentin Doris Leuthard hat am Donnerstag den neuen österreichischen Bundespräsidenten in Bern empfangen. Am Freitag besuchte Alexander van der Bellen die Zürcher ETH und Roche in Basel.
Das Modell der nationalrätlichen Kommission für eine Reform der Altersvorsorge nimmt Rücksicht auf gesellschaftliche Realitäten und kostet erst noch weniger als die Lösung des Ständerates.
Nach dem USR-III-Nein erhöhen SP und CVP den Druck für höhere Renten. Doch FDP und SVP lassen sich nicht beirren und halten an ihrer Linie fest. In der Frühjahrssession geht es um alles oder nichts.
Der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO hat im vergangenen Jahr Renditen zwischen 3,85% und 2,63% erzielt. Auch die IV kann etwas Atem schöpfen.


























