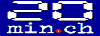
Am Montagabend hat eine Störung die Deutschschweiz erreicht. Diese sorgt für winterliche Stimmung.
Steuerreform, erleichterte Einbürgerungen und ein neuer Verkehrs-Fonds: Wie stimmen Sie am 12. Februar?
Die Waldbrände der letzten Tage waren kaum zu stoppen. Ein Klimaforscher warnt: Unternehmen wir nichts gegen den Klimawandel, drohen schlimme Folgen.
Mit der Klimaerwärmung werden Trockenphasen hierzulande immer häufiger und gefährlicher. Der Bund will entsprechende Massnahmen treffen.
Trotz sinkenden Asylzahlen steigen die Kosten für Gemeinden und Kantone. Sie investieren viel Geld in die Integration. Gleichzeitig sind über 8000 Flüchtlinge abgetaucht.
Auch Befürworter der Zuwanderungsinitiative stehen hinter den Bilateralen mit der EU. Eine Kündigungsinitiative hat laut einer Umfrage keine Chance.
Mit einem Sprung ins kalte Wasser haben in Genf rund 50 Menschen Neujahr gefeiert. Das brauchte Mut, denn das Wasser des Genfersees war 6,8 Grad kalt.
Auf der Riederalp ist ein junger Skifahrer gegen eine Absperrung gefahren. Der Bub starb später im Spital.
Bundespräsidentin Doris Leuthard blickt in ihrer Neujahrsansprache zwar optimistisch ins 2017. Zugleich sagt sie aber auch: «Wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt.»
Ein Drittel der grössten Schweizer Arbeitgeber plant einen Stellenabbau. Konzernchefs fordern die Aufhebung der angenommenen Masseneinwanderungsinitiative.
Seit dem frühen Morgen sind im Tessin Lösch-Helikopter im Einsatz: Der Wald steht teilweise wieder in Brand.
Wie gut integriert sind muslimische Seelsorger im Gefängnis und Imame in Moscheen? Ein neues Verfahren soll fundamentalistische Tendenzen aufdecken.
Das LKW-Attentat in Berlin veranlasst SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner zum Handeln: Er gibt seinen Fahrern Pfefferspray in die Kabine.
Schockierend, emotional oder superlustig: Diese Videos haben die 20-Minuten-Leser 2016 am häufigsten geklickt.

Als weltweit erste staatliche Behörde akzeptiert die Stadt Zug seit Juli eine Kryptowährung. Eine erste Zwischenbilanz fällt durchzogen aus.
Ein guter Vorsatz für das neue Jahr gefällig? Ein umsichtigerer Umgang mit unserer Umwelt zum Beispiel. Wie aber geht es unserem Klima, der Luft, den Flüssen und Wäldern wirklich?
Im uralten Sedimentgestein soll der atomare Abfall seine letzte Ruhestätte finden. Was im Opalinuston in Millionen von Jahren abläuft, untersuchen Spezialisten im Mont Terri.
Seit dem Untergang der Sowjetunion unterstützen private Organisationen und der Bund Projekte in Osteuropa. In Rumänien werden Orgelbauer und Schreiner ausgebildet.
In der Schweiz haben offiziell 44 500 Einwohner am 1. Januar Geburtstag. Mehr als doppelt so viele wie durchschnittlich an anderen Tagen. Das ist kein Zufall.
Bundespräsidentin Doris Leuthard bezeichnet die Schweiz in ihrer Neujahrsrede als einen «Fels in der Brandung», vor allem im Angesicht der derzeitigen politischen Unsicherheit im nahen Ausland.
Das traditionelle Bundesratsfoto kommt dieses Jahr daher wie die Affiche für eine neue, düstere Fernsehserie. Und wer spielt darin welchen Part?
Zu einer typisch schweizerischen Silvesterfeier gehören Tischbomben einfach dazu. Der einzige Hersteller in unserem Land kennt auch die Vorlieben der Franzosen und Deutschen.
Die Debatten um Airbnb und Uber machen deutlich, wie sehr die Politik bei der Digitalisierung der Realität hinterherhinkt. FDP-Nationalrat Fathi Derder möchte das ändern – und stösst dabei auf Widerstand.
Welche Begriffe haben im ablaufenden Jahr in der Schweizer Politik Furore gemacht? Die NZZ-Redaktion hat das Alphabet durchforstet.
Im Sommer 1970 fiel in vertraulichen Gesprächen mit Bundesrat Pierre Graber auch der Name «Khaled». Im Berner Bundesarchiv und in den Memoiren eines Historikers ergibt sich plötzlich eine heisse Spur.
SVP-Bundesrat Ueli Maurer rechnet für das kommende Jahr mit einer komplexeren Migrationslage. Er will das Verteidigungsdepartement daher um Verstärkung seines Grenzwachtkorps ersuchen.
IV-Bezügerinnen, die wegen der Kinder weniger arbeiten möchten, behalten ihre Invalidenrente. Das sagt das Bundesgericht. Den Ball für weitere IV-Anpassungen für Teilzeitler spielt es aber der Politik zu.
Neue Recherchen der NZZ zeigen: Ein Schweizer Nazi und ein militanter Palästinenser sollen beim Geheimdeal zwischen der Schweiz und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) von 1970 wichtige Rollen spielen. Von offizieller Seite wird das mündliche Abkommen verneint.
Der überprüfbare Inhalt eines bis dahin unbekannten FBI-Dokuments decke sich mit seiner langjährigen Forschung – deshalb erachtet es der deutsche Terrorexperte Wolfgang Kraushaar für glaubhaft.
Ein FBI-Bericht lässt den Bombenanschlag von 1970 auf ein Swissair-Flugzeug in neuem Licht erscheinen: In der palästinensischen Terrorgruppe sollen auch zwei Westdeutsche aktiv mitgewirkt haben.
Laut einem Untersuchungsbericht finden sich in den Akten der Bundesanwaltschaft keine Hinweise, dass das Strafverfahren zum Würenlingen-Attentat von 1970 nicht gesetzmässig durchgeführt worden ist.
Vertiefte Recherchen der Verwaltung bringen keine Hinweise auf ein Geheimabkommen. Die Geschäftsprüfer vertrauen darauf. Derweil untersuchen sie die Sistierung des Lenkwaffenprojekts Bodluv.
Als 20-Jähriger lauschte er im Sommer 1970 höchst vertraulichen Gesprächen zwischen seinem Vater und Bundesrat Pierre Graber: François A. Bernaths Erinnerungen bergen Zündstoff.
Der Bericht der behördlichen Arbeitsgruppe zur Causa Graber/PLO ist als Zwischenbilanz nützlich. Er kann aber nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachtet werden.
In der Zuwanderungsdebatte haben sich Volksvertreter zusammengesetzte Wörter an den Kopf geworfen. Das sind nicht Symptome einer Krise, sondern Geräusche einer gesunden Demokratie auf Orientierungssuche.
Die Abstimmung über das Nachrichtendienstgesetz bestimmte in der Schweiz die Debatte über dem Umgang mit der Terrorgefahr. Das neue Gesetz greift ab nächstem Herbst, wenn in bestimmten Fällen Telefone abgehört und Computer verwanzt werden dürfen.
Das Parlament hat die Masseneinwanderungsinitiative mit einem «Inländervorrang light» umgesetzt. Die Allianz für die Bilateralen ist brüchig geworden, die nächste Abstimmung naht.
Am 1. Juni 2016 ist mit dem Basistunnel zwischen Erstfeld und Biasca der längste Eisenbahntunnel der Welt und das zweite Herzstück der Neuen Eisenbahntransversalen durch die Schweizer Alpen eröffnet worden.
Die Schweiz stand unter Strom. Das Bundesrat und Parlament gleisten den langfristigen Umbau der Schweizer Stromversorgung in Richtung erneuerbarer Energien auf. Gleichzeitig hatten die Stimmberechtigten über einen raschen Ausstieg aus der Atomenergie zu entscheiden. Damit wurden wichtige Weichen gestellt.
Die Frage der Altersvorsorge hat die Schweiz auf Trab gehalten. Die Volksinitiative der Gewerkschaften "für eine sichere AHV" verlangte 10 Prozent höhere AHV-Renten für alle und scheiterte an der Urne. In der Rentenreform 2020 geht es nun um die langfristige Sicherung der Vorsorge.
Der Bund will künftig rund fünf statt vier Milliarden Franken jährlich in Strassen investieren. Um diese Mittel zu sichern, will er einen unbefristeten Fonds in der Verfassung verankern. Für den Mehraufwand kommen Steuerzahler und Benützer auf.
Kinder von Secondos sollen sich nach dem Willen des Parlaments erleichtert einbürgern lassen können. Volk und Stände stimmen über die entsprechende Verfassungsgrundlage ab.
Mit dem grossen Steuerreformpaket kommt am 12. Februar eine der wohl komplexesten Vorlagen seit Jahren an die Urne. Im Folgenden die wichtigsten Informationen.
Nach einer wilden Schiesserei auf Grenzwächter wird der berüchtigten deutschen Linksterroristin Gabriele Kröcher-Tiedemann der Prozess gemacht. Ihr Leben endet tragisch – trotz Läuterung.
Südafrikas Apartheidregime sah sich Mitte der achtziger Jahre endgültig in die Ecke gedrängt. Unangenehm wurde es aber langsam auch für die Schweiz, die mit ihm vergleichsweise freundlich verkehrte.
1946 wurden bei Schweizer Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg gravierende Baumängel entdeckt. Die dafür verantwortlichen Militärs und Baufirmen kamen fast ungeschoren davon.
Weil die deutsche Wehrmacht plant, die Bodenseeflotte vor der Ankunft der Alliierten zu versenken, sorgt ein Beamter der Reichsbahn dafür, dass elf Schiffe nächtens in die Schweiz übersetzen.
Der sagenhafte Teufelsstein von Göschenen steht dem Bau des Gotthard-Strassentunnels im Weg und soll daher gesprengt werden. Doch die Urner opponieren und retten 1973 den Klotz – nicht zum ersten Mal.
Mit der Verhaftung von Raphael Huber begann vor 25 Jahren die Zürcher Wirte-Affäre. Die Justizposse ist auch ein Abbild der streng regulierten Zürcher Gastroszene der 1980er Jahre.
Im Spätherbst 1907 feiern die Urkantone und Studenten 600 Jahre Eidgenossenschaft. Obwohl das Datum stark umstritten ist, markiert der Bundesrat mit einer hochkarätigen Delegation Präsenz in der Innerschweiz.
1986 brennt es auf dem Industriegelände Schweizerhalle. Tonnen von Chemikalien landen im Rhein: eine riesige Umweltkatastrophe. Dafür wird das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung gestärkt.
Spitalseelsorgende haben stets ein offenes Ohr für Patienten und Angehörige – ein Besuch in Chur.
Was machen eigentlich die da oben in Bern, wenn sie sich gesetzgebend versammeln? Allerhand, wie flüchtige Eindrücke eines langen Sessionstags zeigen.
Der Weihnachtsrummel ist angelaufen, das grosse Hetzen hat begonnen. Wofür? Im Basler Einkaufstrubel auf der Suche nach dem Sinn von Weihnachten.
Pirmin Schwander ist der Rechtsausleger im Nationalrat, Lisa Mazzone die Linkste – und CVP-Fraktionschefin Viola Amherd die personifizierte Mitte. Die zentralen Erkenntnisse des Parlamentarier-Ratings im Überblick.
Der Freisinn profitiert von der Stärkung des rechten Lagers im Nationalrat – der SVP nützt ihr Wahlsieg von 2015 hingegen kaum. Für die Linke sind harte Zeiten angebrochen.
Die CVP zieht in der kleinen Kammer an einem Strick – dafür ist die SP weniger geschlossen als im Nationalrat. Daniel Jositsch ist auch im Stöckli der rechteste Sozialdemokrat.
Romands politisieren anders als Deutschschweizer, Nationalrätinnen anders als ihre männlichen Kollegen: Das zeigt das NZZ-Parlamentarier-Rating.
Einst haben die Zürcher Fahnenträger die nationale SVP auf strammen Rechtskurs getrieben. Die heutige Zürcher Delegation ist innerhalb der Fraktion ziemlich eingemittet. Dünner ist Zürich auch am rechten Flügel der SP vertreten.
Die erstarkende SVP zieht den Parlamentsschnitt nach rechts. Die SP wird immer linker. Die Grünen pendeln an den Rand und zurück. Zwei Jahrzehnte Nationalrat im Überblick.
Im Felslabor Mont Terri bei St. Ursanne im Jura wird seit 20 Jahren der Opalinuston erforscht. 150 Experimente zu den Eigenschaften des Gesteins sollen nachweisen, wie man ein Endlager für Atommüll bauen kann.
Was läuft im Berner Bundeshaus während einer Session? Wir haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier einen Tag lang beobachtet.
Am 12. Dezember 1988 musste Elisabeth Kopp als erste Bundesrätin der Schweiz vorzeitig zurücktreten, nachdem sie ihren Mann vor einer Strafuntersuchung gewarnt hatte. Am 16. Dezember 2016 wird sie 80.
Im Juni wurde er feierlich eröffnet, ab heute profitieren Nord-Süd-Reisende zum ersten Mal vom Jahrhundertbauwerk. Denn pünktlich zum Fahrplanwechsel vom 11. Dezember 2016 wird der Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen.
Gen Atem ist ein Pionier der europäischen Urban-Art-Bewegung. Er lernte von den Stars des New Yorker Hip-Hop-Undergrounds in den achtziger Jahren. Heute geht er seinen eigenen Weg, schafft Kunst im Spannungsfeld zwischen stiller Einkehr und explosivem Attentat.
Wie ist das deutliche Nein zur Atomausstiegsinitiative zu erklären? Und was bedeutet es für die Energiestrategie 2050 des Bundes? NZZ-Inland-Redaktor Helmut Stalder sieht das Ergebnis als Auftrag für eine Energiewende mit Augenmass.
Die EU zeigt sich erleichtert, dass das Gesetz zur Masseneinwanderungsinitiative das Freizügigkeitsabkommen nicht verletzt. Laut Staatssekretär Mario Gattiker wird sie aber die Umsetzung «genau beobachten».
Seit das Schweizer Stimmvolk die Masseneinwanderungsinitiative angenommen hat verhandeln Parlament, Regierung und EU über deren Umsetzung. Eine Chronologie der Europapolitik seit dem 9. Februar 2014.
Albert Rösti erklärt, wieso die SVP die Gesetzesvorlage zur Umsetzung der Einwanderungsinitiative nicht aktiv bekämpft. Dass die SVP ihren Wahlerfolg kaum in Resultate ummünzen kann, hat für den Parteichef mit der FDP zu tun – und den eigenen Leuten.


























