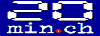
Ein Paar mit einer Erbkrankheit wünscht sich Nachwuchs. Doch es will das Risiko eines kranken Kindes nicht eingehen. Und hofft auf ein Ja am 5. Juni.
Der Wonnemonat wird seinem Namen in diesem Jahr überhaupt nicht gerecht. Der Mai präsentierte sich zu nass und zu kühl. Und eine Wetterbesserung lässt noch auf sich warten.
Die Räuber von der Zürcher Bahnhofsstrasse wurden von vielen Handykameras erfasst. Ein Glücksfall für die Polizei - die immer öfter auf Fotos von Zeugen zurückgreift.
Auch wegen Dating-Apps haben Privatdetektive alle Hände voll zu tun, untreue Partner zu überführen. L.K. erzählt, wie ihr ein Beschatter Gewissheit brachte.
Bei der Unternehmenssteuerreform III geht der Ständerat taktisch vor. Die Ausmarchung mit dem Nationalrat wird zur regelrechten Pokerpartie.
Heute können nur Ehepaare die Stiefkinder ihrer Partner adoptieren. Das könnte sich bald ändern - auch der Nationalrat stützt eine Modernisierung des Adoptionsrechts.
Ein Flüchtling bietet Gesprächsrunden für Väter aus Eritrea an. Seine Hilfe zum Abbau patriarchaler Rollenverständnisse soll nun expandieren.
Kantonslabore haben mehrere Gebäcke untersucht. Mehrere Produkte enthielten falsche Angaben zum Inhalt.
Braucht es mehr Geld für die Strasse? Im Streitgespräch zur Milchkuh-Initiative kreuzen Hans-Ulrich Bigler (FDP) und Cédric Wermuth (SP) die Klingen.
Die Atomaufsichtsbehörde verschärft die Vorgaben. Die AKW müssen einem sehr starken Erdbeben standhalten können.
Auf Online-Plattformen tauchen viele Tickets für die Euro 2016 auf - obwohl die Uefa den Weiterverkauf verbietet. Marktführer Ricardo entfernt solche Angebote.
Die Schweizerische Nationalbank hat rund 600 Milliarden Franken Devisenreserven. Ein Professor schlägt vor, einen Teil davon für Infrastruktur-Bauten zu verwenden.
Mit der Eröffnung des neuen Gotthardtunnels verkürzt sich die Reisezeit auf der Nord-Süd-Achse. Welche Änderungen der neue Fahrplan sonst noch mit sich bringt.
Zuvorkommend und höflich, aber auch kalt und distanziert - so beschreibt ein ehemaliger Mithäftling Kris V. Der verurteilte Mörder habe jegliche Therapie abgelehnt.

Wie erklärt man die Reform der Unternehmensbesteuerung dem Volk? Diese Frage stand am Montag im Zentrum der Debatte des Ständerats.
Die bürgerlichen Bundesratsparteien seien sich bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative einig, verkündete eine Sonntagszeitung. Uneinig seien sich hingegen die Blochers, hiess es am Montag. Beides ist falsch.
Neu können auch Homosexuelle und Unverheiratete Kinder ihres Partners adoptieren. Damit soll das Recht der Realität angepasst werden. Die Gegner zweifeln, ob die Änderung im Interesse des Kindes ist.
Der ehemalige BDP-Präsident Hans Grunder übt scharfe Kritik an der heutigen Parteileitung. Seine Ideen zur Zusammenarbeit in der Mitte stossen aber keineswegs auf so taube Ohren, wie er impliziert.
Dieter Behrings Verteidigung wirft der Bundesanwaltschaft schwere Verfahrensmängel bei den Ermittlungen vor. Dem Beschuldigten werde eine angemessene Verteidigung verweigert.
Die Analysen zur Erdbebengefährdung der AKW sind zu ungenau. Die Aufsichtsbehörde verpflichtet die Betreiber, neue Daten des Erdbebendienstes zu verwenden. Für den Nachweis erhalten sie Zeit bis 2020.
Die Schweiz ist im Hintertreffen: Frauen drängen zwar in den Arbeitsmarkt, doch die Lücke, die sie zu Hause hinterlassen, füllt niemand. Jetzt sollen die Männer in die Bresche springen.
Bewegtbild ist eine schwierige Kunstform. Ernstgemeintes wirkt oft lächerlich, Komisches nur peinlich. Anschauungsunterricht bieten diese Kampagnen-Videos zur Abstimmung vom 5. Juni.
Der diesjährige Fahrplanwechsel am 11. Dezember werde ganz im Zeichen des Gotthards stehen, teilen die SBB mit. Mit der Eröffnung des Basistunnels verkürzen sich die Reisezeiten von Norden nach Süden ab Ende 2016 in einem ersten Schritt um rund 30 Minuten.
Das Feilschen um die richtige Balance bei der Unternehmenssteuerreform III geht in die letzte Runde. Unter Dach und Fach bringen wollen die Räte zudem das Kroatien-Protokoll.
Das Entwicklungshilfe-Budget hat in letzter Zeit stark zugelegt. Umso verwundbarer scheint es nun angesichts der Sparzwänge. Die inhaltliche Debatte ist arm.
Der längste Tunnel durch die Alpen ist das dritte grosse neue Bauwerk auf dem europäischen Eisenbahnkorridor Rotterdam–Genua. Wird das Jahrhundertwerk seinen Zweck erfüllen?
Mit Stolz und Spektakel feiert die Schweiz die Eröffnung des neuen Verkehrskorridors am Gotthard. Doch ausgerechnet die Spitzen der EU haben die Teilnahme abgesagt.
Der Gotthardbasistunnel verbindet Sprachregionen und Nationen. Ein grossartiges Bauwerk allein genügt aber nicht, um die Zentrifugalkräfte einzudämmen, die auf die Eidgenossenschaft einwirken.
Der Gotthard-Basistunnel stärkt einen für die EU zentralen Nord-Süd-Korridor. Wie steht es mit den Anschlüssen? Hat Bern nun einen «Gotthard-Bonus» gut? Eine Nachfrage bei der EU-Verkehrskommissarin.
Mehr Tagestouristen aus der Deutschschweiz, mehr Tessiner Pendler in Richtung Norden – beides dürfte der Entwicklung des Südkantons auch staatspolitisch nützen.
Er scheint ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Nun hat er dem bäuerlichen Establishment den Kampf angesagt – mit Rückenwind aus dem Volk. Denn eine Kuh ohne Horn sei keine richtige Kuh, findet er.
Die dritte Folge der NZZ-online-Serie thematisiert die Betreuung und die Wartung des Bauwerks. Sie sind das Fundament für die Betriebssicherheit des komplexen Röhrensystems.
Simon Gemperli, Inlandredaktor der NZZ, schildert im Video was ein Ja am 5. Juni tatsächlich für Auswirkungen auf das Asylwesen hätte.
Laut einem Untersuchungsbericht finden sich in den Akten der Bundesanwaltschaft keine Hinweise, dass das Strafverfahren zum Würenlingen-Attentat von 1970 nicht gesetzmässig durchgeführt worden ist.
Vertiefte Recherchen der Verwaltung bringen keine Hinweise auf ein Geheimabkommen. Die Geschäftsprüfer vertrauen darauf. Derweil untersuchen sie die Sistierung des Lenkwaffenprojekts Bodluv.
Als 20-Jähriger lauschte er im Sommer 1970 höchst vertraulichen Gesprächen zwischen seinem Vater und Bundesrat Pierre Graber: François A. Bernaths Erinnerungen bergen Zündstoff.
Der Bericht der behördlichen Arbeitsgruppe zur Causa Graber/PLO ist als Zwischenbilanz nützlich. Er kann aber nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachtet werden.
Der Schlussbericht wirft Fragen auf, mit denen sich auch die GPK noch befassen dürfte. Jean Ziegler hält die Resultate der Arbeitsgruppe für «irrelevant», und Buchautor Gyr hält an seiner These fest.
Der Bericht der behördlichen Arbeitsgruppe, welche die Causa PLO untersucht hat, enthält ein Dokument, in dem ein Zeitzeuge von interessanten Aussagen Pierre Grabers berichtet.
Bewegtbild ist eine schwierige Kunstform. Ernstgemeintes wirkt oft lächerlich, Komisches nur peinlich. Anschauungsunterricht bieten diese Kampagnen-Videos zur Abstimmung vom 5. Juni.
Für den 5. Juni zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab: Laut der neusten SRG-Umfrage haben die Gegner von «Pro Service public» massiv aufgeholt. Auch der «Milchkuh»-Initiative droht ein Crash.
Am 5. Juni wird das Schweizer Stimmvolk zur Urne gebeten. Die politischen Parteien und Interessensvertretungen haben ihre Parolen gefasst. Finden Sie hier einen Überblick über alle Wahlempfehlungen.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs kritisieren die Alliierten die Schweiz heftig wegen deren Wirtschaftsbeziehungen zum «Dritten Reich». Ein Deal löst schliesslich die politischen Spannungen.
Im Mai 1996 wird der kauzige Nationaltrainer Artur Jorge zum Feindbild, weil er an der EM-Endrunde in England nicht auf Publikumsliebling Sutter setzen will. Aber es geht um mehr – ein Blick zurück.
Moritz Conradi, ein Auslandschweizer und glühender Antikommunist, erschiesst im Mai 1923 einen prominenten Bolschewisten. Das Urteil löst politische Schockwellen aus – ein Blick zurück.
Im Wettrennen um die Erstbegehung der höchsten Berge der Welt mischt auch die Schweiz mit. Im Mai 1956 gelingt ein Prestigeerfolg – ein Blick zurück.
Am Wiener Kongress diskutieren die Siegermächte, wie mit Genf zu verfahren sei. Die dabei gewählte «Schweizer Lösung» ist nicht unproblematisch – ein Blick zurück.
Am letzten Aprilsonntag 1991 nehmen in Appenzell die Frauen erstmals an der Landsgemeinde teil. Die Innerrhoder Männer haben sich dagegen gewehrt, das Bundesgericht hat entschieden.
Eine Flugzeugkatastrophe auf Zypern führte 1967 in Basel zu einem wirtschaftlichen Erdbeben – und schliesslich zu einer kulturellen Euphorie. Pablo Picasso persönlich spielte in der Geschichte eine Hauptrolle.
Die Ständeratskommission stellt Bedingungen für die Kroatien-Ratifikation. Die entscheidende Frage wird dabei nicht angesprochen.
Der Gotthard-Basistunnel stärkt einen für die EU zentralen Nord-Süd-Korridor. Wie steht es mit den Anschlüssen? Hat Bern nun einen «Gotthard-Bonus» gut? Eine Nachfrage bei der EU-Verkehrskommissarin.
Der Bundesrat will mit der EU noch im Hochsommer eine Vereinbarung zur Zuwanderung aushandeln, um die Fristen einzuhalten. Es könnte viel länger dauern.
Der emeritierte Demokratie-Experte Wolf Linder hält nichts von einem kantonalen Fusionszwang für Gemeinden.
Die mittelschwedische Grossgemeinde Älvdalen sucht Synergien in Kooperationen über die weiten Grenzen hinaus. Doch der Lokalpatriotismus ist gross.
25 Gemeinden zählt der Bezirk Greyerz heute – ein ambitiöser Plan sieht vor, sie alle abzuschaffen. Die Idee kommt wider Erwarten gut an.
Im kleinräumig strukturierten Aargau existiert kein städtisches Zentrum. Das wird sich nicht so schnell ändern.
Die Bündner Grossgemeinde Lumnezia darf ihre Exekutive nicht verkleinern. Man müsse den Fusionsvertrag einhalten und die Minderheit der Stimmbürger berücksichtigen, argumentiert die Regierung.
Die Fusion zur Stadt mit fast 70'000 Einwohnern verursacht in Lugano höhere Kosten. Dies führt auch zu kuriosen Sparmassnahmen, die mit Wasser und WC's zu tun haben.
Bald zehn Jahre sind seit der Vereinigung von Rapperswil und Jona vergangen. Die Ziele sind weitgehend erreicht. Rapperswil-Jona ist die grösste Stadt, die auf eine Bürgerversammlung setzt.
Ein Fotoband dokumentiert das Kindsein in der Schweiz im Wandel der Zeit. Was hat sich geändert, was ist geblieben?
In einem Buch präsentiert sich der neue SP-Nationalrat Tim Guldimann als Überzeugungstäter. Auch der Bundesrat wird nicht geschont.
Auch das stabile Politsystem der Schweiz kennt Skandale. Die neue «Traverse» nimmt einige unter die Lupe, aber nicht rundum überzeugend.
Ein neues Geschichtsbuch über Davos wirkt so verwinkelt wie die dort wirkenden Dynamiken. Das Werk ist lesenswert, weil man feststellt, dass ein Ort nicht auf ein einziges Pferd setzen kann.
In einem neuen Buch denken Entwicklungsexperten, Agronomen und Ethiker über fairen Handel und ein gerechtes und demokratisches Ernährungssystem nach und schreiben so eine astreine Kapitalismuskritik.
Eine Studie über Pro Senectute in der Zeit von 1917 bis 1967 zeigt vielfältige Wechselwirkungen zwischen privater und öffentlicher Fürsorge, allgemeiner Modernisierung und Konzeptionen des Alters.
Über 60'000 Objekte aus Berner und Schweizer Schulstuben ruhen in Köniz bei Bern unter der Erde. Sie zeugen vom Wesen und Wandel der Volksschule der letzten zwei Jahrhunderte.
Der Gotthardbasistunnel ist viel mehr als Röhren im Berg. NZZ-Fotograf Christoph Ruckstuhl hat dokumentiert, wie das Grossbauwerk in der Landschaft am Gotthard sichtbar wird.
In einem speziellen Kurs lernen Hirten in Ausbildung den Umgang mit dem Herdenhund. Die Ausbildung liegt besonders bei Frauen im Trend.
Die Anlagen mancher Laufentaler Industriebetriebe liegen seit Jahren brach. Andere Betriebe liefern ihre Erzeugnisse auch heute noch bis in ferne Länder.


























