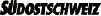
Die Kammerphilharmonie und Graubünden Brass zählen zur musikalischen Elite im Kanton. Doch die prekäre Probenraumsituation in Chur macht ihnen zu schaffen. Nun schlagen sie Alarm.
Die Bündner Tourismusgemeinden brauchen Erstwohnraum. Falls überhaupt gebaut wird, spielt die Architektur selten eine Rolle – und so sehen die Ortskerne dann auch aus. San Bernardino zeigt jetzt, wie es anders geht.
Mit insgesamt mehreren Zehntausend Eintritten sind die Klassikfestivals ein Wirtschaftsfaktor im Kanton. Zu bieten haben sie aber weit mehr als blosse Taktzahlen. Ein Überblick.
In Chur gibt es Bilder und Skulpturen von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus Namibia zu sehen. Wir haben mit einem von ihnen, Fillipus Sheehama, über die Arbeit und seine Karriere gesprochen.
In diesem Sommer wird Soazza zum kulturellen Hotspot im Misox. Zilla Leutenegger, Künstlerin und Mitinitiantin von Arte Soazza, erzählt von der Idee und was Besuchende erwartet.
Philipp Gurt und Joachim B. Schmidt sind die erfolgreichsten Bündner Autoren der Gegenwart. In den Ranglisten sind sie Konkurrenten. Persönlich verstehen sie sich bestens – regelmässige Telefonate inklusive.
Bündnerinnen und Bündner haben die Qual der Wahl. So viele unterschiedliche Festivals gibt es im Kanton. Wo lohnt es sich hinzugehen?
Martin Zimmermann war nicht nur Lehrer an der Evangelischen Mittelschule Schiers. Auch als Chorleiter, Musiker und Dirigent hat er im ganzen Kanton Spuren hinterlassen. Jetzt nimmt er Abschied vom Berufsleben.
Bibi Vaplan wird mit dem rätoromanischen Kulturpreis der SRG ausgezeichnet. Genau zur richtigen Zeit, sagt die Bündner Musikerin, denn ihre Projekte könnten weiteren Anschub gut gebrauchen.
Zehn Kunstschaffende wohnen und arbeiten zurzeit in der «Residenza» in Rumein. Sie erzählen, was die Berge mit ihnen machen – und warum Konzerte eine gute Möglichkeit sind, Einheimische kennenzulernen.
Mit «L'ultim Rumantsch» hat RTR einen Überraschungserfolg gelandet. Noch überraschender: Die Miniserie hat nun Chancen auf einen Prix Walo. Derweil wird die zweite Staffel gerade fertiggestellt.
Jetzt ist er eröffnet: der Weisse Turm in Mulegns. Bis er enthüllt werden konnte, war Geduld gefragt – beim Bau selber, aber auch am Eröffnungstag.
An der Biennale in Venedig spielen Architektinnen eine wichtige Rolle. Das war in diesem Beruf leider nicht immer so, auch nicht in Graubünden. Architektin Corinna Menn erzählt.
Seit 50 Jahren leitet Rico Caviezel aus Paspels den Kirchenchor Concordia Ausserdomleschg. Nun steht er zum letzten Mal am Dirigentenpult. Einst besserte er mit Musik seinen Lehrlingslohn auf.
Die Theaterautorin Sarah Calörtscher hat mit «Grounding» Bündner Erstaufführung gefeiert. In Ilanz geboren, ist sie nun zurückgekehrt. Und fragt sich gemeinsam mit der Kompanie Softsoil: Wie sicher ist die Schweiz?
Vom Davoser Expressionisten bis zum britischen Weltstar: Der Churer Galerist Manuel Solcà stellt fünf Werke vor, die seine kommende Ausstellung besonders prägen. Und er gibt Einblicke in den verschwiegenen Kunstmarkt.
Der Eurovision Song Contest ist für die Gastgeberländer immer auch eine Gelegenheit, sich im besten Licht zu zeigen. Graubünden kommt dabei prominent vor – andere Kantone sind leer ausgegangen.
Nach dem Verschwinden von Kinocenter und Kino Apollo gibt es in Chur nur noch das Blue Cinema am Stadtrand. Wir haben die Betreibenden gefragt, wie sie mit der Monopolstellung umgehen und ob sie künftig mehr Nischenfilme zeigen werden.
Science-Fiction ist schon lange Popkultur. Zwei junge Theatermacher erzählen, wie sie künstliche Intelligenz auf die Bühne der Postremise bringen.
Seit bald 14 Jahren ist Stephan Kunz künstlerischer Direktor des Bündner Kunstmuseums. Im Gespräch verrät er, was ihn einst nach Chur gelockt hat. Und er spricht über die schwierigen Zeiten, als das Museum ins Schussfeld der Politik geriet.
Peach Weber ist auf grosser Tournee durch die Schweiz. Im November kommt er nach Chur. Im Interview verrät er, wieso er eher unverhofft zum «King of Gäx» geworden ist und wieso Ehen nach sieben Jahren geschieden werden.
Der Regisseur Georg Scharegg hat im Theater Chur einen Bündner Roman von Leta Semadeni auf die Bühne gebracht. Was daran klappte – und was nicht so ganz.
Aus Graubünden schaffen es vor allem Joachim B. Schmidt und Philipp Gurt in die Bestsellerlisten. Das heisst, sie verkaufen mehr Bücher als die Konkurrenz. Wie viele mehr, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Was es ihnen bringt, dagegen schon.
Seit 20 Jahren dirigiert Christina Battaglia den Jodelclub Calanda in Chur und ist damit seine dienstälteste Leiterin. Dies, obwohl sie mit Jodeln ursprünglich so rein gar nichts anfangen konnte.
Viele Jahre war sie die aufmerksame Beobachterin der hiesigen Kunstszene und wurde für ihre Berichterstattung sogar von der Bündner Regierung ausgezeichnet. Was macht Gisela Kuoni mittlerweile? Wir haben sie besucht.
Der Begriff guilty pleasure bezeichnet etwas zutiefst Menschliches. Es gibt Dinge, die wir mögen; wir schämen uns aber, es zuzugeben. Wir haben bei Bündner Kunstschaffenden nachgefragt, was ihre guilty pleasures sind – und mischen jene der Kulturredaktion darunter.
Sein Berufsleben lang war er Realschullehrer mit Leidenschaft – doch eine zweite Passion hat Hans-Jörg Riedi ebenso gepflegt: das Filmen. Im Kanton war er damit so etwas wie ein echter Pionier.
Seit 2018 plant und baut Origen mit der ETH Zürich ein besonderes Gebäude in Mulegns. Nun ist der Weisse Turm beinahe fertig. Die Kosten waren deutlich höher als erwartet.
Die Domleschger Band Calabrun spielt nach eigenen Worten «Worldjazz grischun». Was dies bedeutet und wie sich die drei Musiker gefunden haben: Wir haben mit ihnen im Probelokal darüber gesprochen.
Massimo Gurini legt weltweit in bekannten Clubs und an Grossanlässen auf. Begonnen hatte seine internationale Karriere einst mit einer DJ-Kanzel in seinem Kinderzimmer.

Der erste Roman eines Faktencheckers über einen Faktencheckerwirft die Frage auf: Warum ist dieser Beruf, den es doch so braucht,dermassen in Verruf geraten?
Die leidenschaftliche Depressivität von Tor Ulvens Schreiben zerstört jede Art von bürgerlicher Sicherheit. Am Ende geht es dem Norweger in seiner unerhört präzisen und emotionslosen Prosa darum, zu zeigen, «dass das Leben streng genommen unmöglich ist».
Der Uni-Abgänger soll den CEO eines Krankenversicherers mit mehreren Schüssen getötet haben. Nun wird er sogar in einem Musical gewürdigt.
Der preisgekrönte Science-Fiction-Roman «Tokyo Sympathy Tower» der japanischen Autorin Rie Qudan geht den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den Einzelnen und die Gesellschaft nach. Es erweist sich, dass der Maschine nichts Menschliches fremd ist.
Der Autor Werner Bellwald hat beim Felssturz im Lötschental alles verloren. Er schreibt über seine 96-jährige Mutter, die nun in einer WG lebt. Und über Politiker, die das Care-Team nötiger hätten als die Einheimischen.
Nach Hitlers Machtergreifung hatte der Schriftsteller Deutschland verlassen. Aber er mied es, sich öffentlich zur Emigration zu bekennen. Zu Jahresbeginn 1936 änderte sich die Lage schlagartig.
Jubelnde Massen, willige Erfüllungsgehilfen: Das ist das Bild, das man vom «Dritten Reich» hat. Peter Longerich vertritt in seinem neuen Buch die These, die meisten Deutschen seien keine überzeugten Nazis gewesen, sondern Konformisten.
In seinem Roman lässt Thomas Mann den Komponisten Adrian Leverkühn den Freudenjubel der Neunten und ihre Verheissung einer Menschheitsverbrüderung unter dem Eindruck der Zeitläufte zurücknehmen. Aber was heisst das eigentlich?
Nach fünfzig Jahren erscheint ein Bericht über Verbrechen der Wehrmacht erstmals auf Deutsch, Gerhard Paul erzählt vom Ende des «Dritten Reichs», und David Blackbourn zeigt, dass deutsche Geschichte nicht an den Landesgrenzen haltmacht.
Der neue Fall für die Ermittler Fellner und Eisner beweist, dass das öffentlichrechtliche Fernsehen zur Intelligenz fähig sein kann.
Die Rede von den drei abrahamitischen Religionen sei ein Täuschungsmanöver, schreibt der Autor Chaim Noll. Die Gleichstellung von Judentum, Christentum und Islam verschleiere das Gewaltpotenzial des Koran.
Berlin hat eine grosse russische Diaspora, seit dem Ukraine-Krieg leben noch mehr Russen hier. Dabei wollen Exilanten und Putinisten nichts miteinander zu tun haben: Wie geht das im Alltag?
In Nigeria massakrieren Islamisten Tausende Christen. Die Reaktionen im Westen sind bezeichnend.
Die Kulturtheoretikerin Christina von Braun und der Psychiater Tilo Held deuten die Krisen der Gegenwart. In ihrem Buch empfehlen sie: mehr Psychoanalyse statt ideologischer Verbohrtheit! Eine Begegnung.
Sie war ein erfolgreiches Model, eine aufstrebende Sängerin und schuf mit «Me & U» einen Kulthit des 2000er-Pop. Dann soll P. Diddy sie einem Kreislauf von Machtmissbrauch und Gewalt unterworfen haben. Szenen einer Karriere, die vorbei war, bevor sie anfangen konnte.
Das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 hat nicht nur Israel erschüttert, sondern die gesamte jüdische Welt. Vor allem säkulare Juden stellen sich seither Fragen zu ihrer Identität.
Die Auflagen zu Gleichstellung und Inklusion sind für viele Schweizer Hochschulen heute schon einschneidend – nun sollen sie erweitert werden.
Für die unmittelbare Zukunft hängt viel davon ab, wie und ob der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew sieht eine Zeit der Barbaren heraufziehen.
Trump kann noch so wüten: Der Antiamerikanismus bleibt bisher erstaunlich zahm. Das hat auch mit Europas Formschwäche zu tun.
Der neue Film «The Phoenician Scheme» des amerikanischen Regisseurs hat dasselbe Problem wie die beiden letzten: Er ist grossartig verfilmt, lässt einen aber kalt.
Der Film «Karate Kid: Legends» ist ein deftig-dramatischer Spass. Und eine Aussöhnung verfeindeter Systeme.
Für seinen Film über Klaus Barbie gewann Marcel Ophüls einen Oscar. Als Dokumentarfilmer bezog er Stellung, und selbst an historischen Stoffen interessierte ihn die menschliche Seite. Nun ist der deutsch-französische Regisseur im Alter von 97 Jahren gestorben.
Das Zürcher Ginmaku-Filmfestival wirft einen Blick auf Japans Ureinwohner. Einmal mehr fokussiert das Filmprogramm auf Menschen am Rand der japanischen Gesellschaft.
Tiefgründiger wird’s nicht in diesem Fall von handelsüblicher Krimiküchenpsychologie. Aber es lohnt sich dennoch, dranzubleiben.
In den letzten fünfzehn Jahren erwies sich die Band um den Sänger Dan Reynolds als eine der erfolgreichsten Rockformationen. So erstaunt es nicht, dass Imagine Dragons im Stadion Letzigrund zweimal für ein Volksfest sorgen kann.
Der deutsch-amerikanisch-persische Musiker kombiniert klassische Werke mit Gedichten von Allen Ginsberg – das lässt sie aufregend anders klingen. Das ungewöhnliche Projekt «Songs with Words» wird am Samstag an Igor Levits «Klavier-Fest» in Luzern aufgeführt.
Die Liebesverbindung von Poesie und Musik war der Angelpunkt seines einzigartigen Künstlerlebens. Vor hundert Jahren wurde Dietrich Fischer-Dieskau geboren.
Mit ihrem Bühnenwerk «Die dunkle Seite des Mondes» beleuchtet die preisgekrönte Komponistin die Abgründe des genialen Physikers Wolfgang Pauli. Leider schwächt das Textbuch das originelle Konzept.
Der nigerianische Pop-Star reflektiert sein Leben und den Kampf seiner berühmten Familie gegen politische Missstände. In seiner Musik verbindet er Spiritualität mit seiner persönlichen Gefühlslage.
Die Friedensdividende ist verprasst, und Deutschland muss wieder aufrüsten. Der Wirtschaftshistoriker Albrecht Ritschl fordert ein nüchternes Verhältnis zu militärischer Abschreckung und erklärt, warum ökonomische Logik im Krieg nicht zählt.
Die Schlacht von Stalingrad im Winter 1942/43 war ein geschichtlicher Wendepunkt: Sie störte die nationalsozialistische Tötungsmaschinerie und brachte sie letztlich zum Einhalt.
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Der deutsche Historiker Norbert Frei sagt, wie die Transformation des Nazistaats gelang – und wie er die Gefahr eines neuen Faschismus einschätzt.
Vor fünfzig Jahren dokumentierten weissrussische Schriftsteller Kriegsverbrechen, die die Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs begangen hatte. Jetzt erscheint der Bericht erstmals auf Deutsch.
Das Deutsche Reich lag in Scherben, das Ende des Zweiten Weltkriegs war nur noch eine Frage der Zeit. Und Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, verhandelte in Österreich über eine Nachkriegsregierung.
Die Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs sind vorbei. Aber fertig wird man mit dem Thema nie: Wir stellen Bücher vor, die in den letzten 75 Jahren Debatten auslösten und Reflexionen anstiessen – oder unsere Sicht auf den Krieg bis heute prägen.
Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Offiziell. In einzelnen Teilen Deutschlands war er schon viel früher fertig. Und in Japan stand das Schlimmste noch bevor.
Vor achtzig Jahren trafen sich die «Grossen Drei» zu Verhandlungen über die Nachkriegsordnung. Was sie damals beschlossen, unterscheidet sich fundamental von der Legende über jene Konferenz, die tief in vielen Köpfen sitzt. Das hat politische Folgen bis heute.
Die Literatur deutschsprachiger Secondos erlebt einen Boom. Ihre Romane erweisen sich als Spiegel deutscher Konfliktzonen. Allerdings sorgen Klischees, Ironie und Ressentiments für krasse Verzerrungen.
Sie alle waren in Kalifornien im Exil: Franz Werfel, Bertolt Brecht, Heinrich und Thomas Mann und Berthold Viertel. Mitsamt ihren Ehefrauen, von denen meist weniger die Rede ist.
In seinem Gedichtband «Vinegar Hill», der jetzt auf Deutsch erscheint, wird der Lyriker und Essayist zum Archäologen scheinbarer Nichtigkeiten. Auf der Rückseite des Glücks lauert bei Colm Tóibín immer die Trauer.
Im Gefängnis schrieb er einen seiner bedeutendsten Romane, mehrmals galt er als Favorit für den Nobelpreis: Nun ist Ngugi wa Thiong’o 87-jährig gestorben.
Aus reinem Hochmut habe sich Joe Biden zu einer weiteren Kandidatur bewegen lassen, schreiben Jake Tapper und Alex Thompson in ihrem Buch «Hybris». Als Richter sind die beiden Autoren eine Fehlbesetzung.
Stephan Balkenhol ist ein deutscher Bildhauer von Weltrang. Seine Skulpturen laden die Betrachter ein, über sich selbst nachzudenken. Für die NZZ hat er nun eine eigene Kunstedition geschaffen.
Esther Mathis ist in den letzten Jahren aufgefallen mit poetischen Werken, in denen oft physikalische Erkenntnisse mitschwingen. Für die NZZ hat sie nun die Farbtöne von Gewitterstürmen in ebenso reduzierten wie reizvollen Objekten gebannt.
Für Katharina Grosse kann alles zum Bildträger werden. Sie bemalt nicht nur Leinwände, sondern auch Wände, ganze Räume und Fassaden. Neuerdings nützt sie auch gebogenes und gewalztes Aluminiumblech als «Unterlage» für ihre genauso überlegte wie spontane Malerei in starken Farben.
Auf einem grossen Tisch liegen Materialmuster und Zeichnungen, rundherum wimmelt es von riesigen Leinwänden in leuchtenden und vibrierenden Farben, die teilweise noch auf ihre Fertigstellung warten. Wer das Studio von Renée Levi und ihrem Partner Marcel Schmid besucht, taucht augenblicklich in ein sinnliches künstlerisches Universum ein.
Essen feiert Alma Mahler. Die Schlüsselfigur der Wiener Moderne ist der Star des Festivals «Doppelbildnisse». Eine Ausstellung im Museum Folkwang rückt dabei die Beziehung zu Oskar Kokoschka ins Zentrum.
Neben seine Leidenschaft für Jets und schnittige Autos trat auch eine ausgeprägte Liebe für die Schönheit der Schweizer Alpen. Der britische Architekt, bekannt für seinen sanften Modernismus, wird 90 Jahre alt.
Vor hundert Jahren wurde Arnold Odermatt geboren. Mit seinen sachlich-nüchternen Aufnahmen von Autounfällen für den Polizeirapport schuf er eine einmalige Ästhetik des Desasters.
Die Katastrophen von gestern sind die Katastrophen von morgen. Das zeigt die Ausstellung «European Realities» in Chemnitz.
Der Schweizer hat die Plastik revolutioniert und in seiner Kunst den Leerlauf gefeiert. Sein Geist lebt weiter in einer Basler Geisterbahn.
Gegen Demis Volpi, den Nachfolger John Neumeiers beim Hamburg Ballett, regt sich Widerstand. Ursache des Problems ist ein nicht bewältigter Generationswechsel im Tanz.
Elfriede Jelineks Stück «Burgtheater» spiesst die NS-Verstrickungen von Österreichs berühmtester Schauspielerfamilie auf. Milo Rau zeigt es im Rahmen der Wiener Festwochen jetzt erstmals am Ort des Geschehens.
Lukas Bärfuss hat ein Solostück über den Wahlkampf des texanischen Senators Ted Cruz verfasst. Die Uraufführung am Schauspielhaus Zürich sorgt für Amüsement. Der Bezug zur amerikanischen Wirklichkeit aber bleibt verschwommen.
Nichts spricht dagegen, wenn Journalisten die Identität eines erfolgreichen Meinungsmachers lüften und sich mit seiner Arbeit auseinandersetzen. Bei «Zeit» und ZDF ging es kürzlich jedoch um etwas anderes.
Wer Wladimir Putins Russland und die osteuropäischen Staaten verstehen will, kommt um «Osteuropa» kaum herum. Jetzt wird die Zeitschrift hundert Jahre alt.
In einem vielbeachteten Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht Roger Schawinski die Konzession für einen neuen Radiosender entzogen. Doch der einstige Radiopirat gibt nicht auf.


























