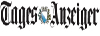
Lukas Bärfuss' neues Buch kommt manchmal daher wie ein Leitartikel.
So siehts im Kopf eines Wutbürgers aus, meint der Karikaturist.
Güzin Kar über die subjektive Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Fakten ersetzt.
Dem erfolgreichsten Youtuber der Welt wird Antisemitismus vorgeworfen – doch PewDiePie behauptet: Ist nur ein Medienexperiment.
Die Graphische Sammlung der ETH Zürich ist nur zwölf Jahre jünger als die Hochschule selbst. Nun feiert sie ihr 150-Jahr-Jubiläum – mit einer Ausstellung, die bis ins Helmhaus «überschwappt».
Kaum einer spottet so schön über die Welt wie Endo Anaconda. Für das neue Album von Stiller Has hat er sich der Bluesrock-Speckledrigkeit entledigt.
Wer junge Menschen verstehen will, muss ihre Musik hören. Aus Anlass des neuen Albums von Jeans for Jesus: Das Leben an und für sich – erzählt in deutschsprachigen Songtexten.
Das Musical «La La Land» ist 14-mal für den Oscar nominiert. Wir haben schon einmal zehn Journalisten in die Romanze geschickt.
Ein Franzose lebt eine Woche in einem Stein. Aus diesem Anlass: sieben Hardcore-Performances der Kunstgeschichte.
Man gehöre nicht zu «denen da oben», betont die Schweizerische Volkspartei. Aber wer dann?
Der Historiker Peter Blickle, lange Jahre Professor in Bern, ist mit 79 Jahren gestorben.
«Alles Walzer» – der diesjährige Wiener Opernball begann mit Stille. Die 5000 Gäste haben der kürzlich verstorbenen Gesundheitsministerin gedacht, unter ihnen Goldie Hawn.
Rekord-Serie, erster Teil: Dieses Instrument wurde vor knapp 300 Jahren gebaut – und klingt immer noch ziemlich gut.
Wir präsentieren jede Woche einen Kulturschnipsel. Erkennen Sie, was dahintersteckt?

Stefan Bachmann inszeniert Schillers «Wilhelm Tell» am Theater Basel als radikale Spoken-Word-Oper. Der Regisseur feiert damit eine triumphale Rückkehr an seine einstige Wirkungsstätte.
Die Politik schaltet Konflikte derzeit gerne aus, statt ihnen eine Form zu geben. Aber Demokratie lebt durch den Streit.
Das Landesmuseum Zürich widmet sich dem Staatsstreich der Bolschewiki von 1917 und dessen Folgen. In der opulenten Schau werden auch die überraschend engen Verflechtungen mit der Schweiz thematisiert.
Stefan Bachmann kehrt nach Basel zurück und bricht eine Lanze für das Ensembletheater.
Ein Mann kommt sich abhanden, weil er blindlings einer unbekannten Frau folgt. Lukas Bärfuss' neuer Roman klingt klischiert. Der Autor indessen entwickelt nun ein faszinierendes Schauspiel gegen das Klischee.
Die «Montforter Zwischentöne» in Feldkirch schauen in die Zukunft der Musikfestivals und geben dem Festspielgedanken einen neuen Sinn.
Die Schauspielerin Isabelle Huppert hat mit den namhaftesten Regisseuren zusammengearbeitet und sich in den ungewöhnlichsten Rollen profiliert. Nun könnte ihre Karriere mit einem Oscar gekrönt werden.
Die Klage über den Zustand der Germanistik kehrt alle Jahre wieder, wird als stereotyp zurückgewiesen und berührt doch wunde Punkte.
Isländische Satiriker und Kritiker leben gefährlich in Zeiten von Trump – bis zu sechs Jahre stehen auf die Beleidigung von Staatsoberhäuptern. Jetzt soll das anachronistische Gesetz gekippt werden.
Was als zivilgesellschaftliche Revolte begann, hat sich zu einem unvorstellbar brutalen Bürgerkrieg entwickelt. Wie sollen wir mit den Bildern umgehen, welche die Abgründe dieses Konflikts zeigen?
Ein siebenjähriges Mädchen gerät in Abwesenheit der Eltern in Lebensgefahr. Ist der Babysitter schuld? Doch in der Inszenierung des versierten Schauspielers Tilo Nest wirkt das Leid allzu unterkühlt.
Der mit 5000 Euro dotierte Alfred-Kerr-Preis geht in diesem Jahr an den NZZ-Literaturkritiker Andreas Breitenstein. Die Jury würdigt seine genaue Urteilskraft und seinen weiten literarischen Horizont.
Die litauische Hauptstadt Vilnius feiert eine kulturelle Vielfalt, mit der sie sich lange schwertat.
Wer so spielt wie die Geigerin Julia Fischer, kann dem Publikum auch spröde Kost vorsetzen: Unter der Leitung von Charles Dutoit interpretiert sie das grossartige 2. Violinkonzert von Béla Bartók.
Sie spielt bedingungslos, ist eine der wandlungsfähigsten Schauspielerinnen Frankreichs und hat fast jeden wichtigen Filmpreis gewonnen: Isabelle Huppert. Doch für einen Oscar hat es noch nicht gereicht. Am Sonntag könnte sich das ändern.
In der Nacht auf Montag verleiht die Academy zum 89. Mal die Oscars. Wer «La La Land» noch vor der Sonne steht. Was Meryl Streep von allen abhebt. Und wie viel die vergoldete Statue eigentlich wert ist. Anekdoten und Wissenswertes im grossen Oscar-Quiz.
Danke an die Eltern, an das Team und überhaupt an die ganze Welt – viele Reden der Gewinner an den Oscar-Verleihungen strapazieren die Geduld des Publikums. Dabei sollte die Danksagung offiziell nicht länger als 45 Sekunden dauern. Doch kaum einer hält sich daran.
Alle reden über Donald Trump und Rechtspopulisten – und die Berlinale, das traditionell politischste Filmfestival, feiert die Empathie. Ist das Ausdruck von Eskapismus und Ohnmacht?
Weshalb wir angesichts von Volker Schlöndorffs Max-Frisch-Hommage «Rückkehr nach Montauk» einem Literaturprofessor dankbar sein müssen. - Und Andres Veiels «Beuys» grosse Kunst ist.
An der Berlinale gibt es diesmal viel zu lachen, etwa über Sally Potters Gesellschaftskomödie «The Party». Warum lässt aber das Vordringen des Unterhaltsamen manche einen Niveauverlust fürchten?
Tippen ist Silber: Textnachrichten mögen unglaublich praktisch sein. Genau deswegen sollten wir mehr miteinander sprechen. Zweckmässigkeit und Rationalität gibt es schon genug in unserem Alltag.
Noch nie ging es den Menschen besser als heute. Und trotzdem nehmen Wut und Unzufriedenheit allenthalben zu. Populisten wissen dies zu bewirtschaften, schreibt die niederländische Schriftstellerin Pauline de Bok.
Ein Essay des Philosophen Peter Sloterdijk über den Einflüsterer, der die Moderne entscheidend prägt.
Bertrand Grébaut führt die zurzeit angesagteste Sterneküche von Paris. Dass man bei ihm an einfachen Holztischen isst und die Kellner Turnschuhe tragen, erhöht den Genuss.
Israels Orthodoxe ziehen viel Unmut auf sich. Aber auch Strenggläubige suchen Wege in die Zeitgenossenschaft – so etwa die jungen Filmemacherinnen.
Nur um Kricket dreht sich Aravind Adigas jüngster Roman. Nur? Im Kricket, so findet der Schriftsteller, bilden sich politische, wirtschaftliche und persönliche Aspekte ab, die Indien heute prägen.
Marokko will den religiösen Extremismus im Keim ersticken – und legt dafür eine Parforceleistung hin.
Anderthalb Schritte vor, einen zurück – so kämpfen Irans reformorientierte Kulturbeauftragte um Freiräume für die Kunst. Auch im Bildungsbereich strebt man kleine Entschärfungen der Doktrin an.
Alle lieben ihn: David Hockney ist in der Tate Britain eine Retrospektive der Superlative gewidmet.
Der aus Burkina Faso stammende und in Berlin tätige Architekt Diébédo Francis Kéré wird den diesjährigen Serpentine Gallery Pavilion in London bauen. Bereits konnten die ersten Computeranimationen vorgestellt werden.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine ändert sich radikal. Sind wir dafür bereit?
Für den Künstler Max Grüter, der jahrelang die Titelblätter des «NZZ-Folios» gestaltete, ist der Computer eine Palette. Als virtueller Raumfahrer materialisiert er damit seine Phantasien.
Weltweit bekannt wurde der Würzburger Bildhauer Fritz Koenig durch seine kugelförmige Plastik in New York, die bei den Anschlägen vom 11. September nur leichte Beschädigungen erlitt. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.
Pablo Larraíns «Neruda» spielt poetisch mit den Möglichkeiten des Geschichtenerzählens.
Der Debütfilm des jungen Schweizer Regisseurs und Theatermanns Michael Koch ist eine eindringliche Sozial- und Charakterstudie. Margarita Breitkreiz brilliert darin als skrupellose Glückssucherin.
Gore Verbinskis neuer Film spielt in einem höllischen Spa, in dem das Unheimliche lauert. Das halluzinatorische Unbehagen inszeniert er mit Sorgfalt und Lust an der spekulativen Übertreibung.
Peter Bergs Actionthriller über den Anschlag auf den Boston Marathon im April 2013 rekonstruiert das chaotische Geschehen und scheut dabei keine drastischen Bilder.
Der neue Schmachtfetzen von Lasse Hallström über einen Hund, der in immer neue Leben hineingeboren wird, schwelgt in rührseligen Klischees und ermüdenden Wiederholungen.
In der «Tatort»-Folge «Tanzmariechen» müssen sich die Kommissare Ballauf und Schenk in die gruppendynamischen Prozesse eines Kölner Karnevals-Tanzkorps hineindenken.
Das Ermittlerteam Brasch und Köhler muss einen Entführungsfall lösen. Doch Schwindeleien und das eigene Urteilsvermögen machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Serien wie «Mr. Robot» zeigen, worin das neue, interaktive Fernseherlebnis besteht: Das Medium der Vereinzelung wandelt sich zum Medium der Verständigung.
Die Schauspielerin wird nur noch zweimal als Kommissarin Sarah Brandt zu sehen sein. Das NDR bedauert diesen Schritt.
Die erste Staffel von «Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events» ist der Anfang vom Ende mit Schrecken: Morbide, schrill, selbstreferenziell.
Mit dem TV-Zweiteiler «Landgericht» nach Ursula Krechels gleichnamigem Roman rückt die verdrängte deutsch-jüdische Nachkriegsgeschichte in den Blick.
Am 23. Februar feiert der Basler Musik-Bahnhof sein fünfzehnjähriges Bestehen: eine Erfolgsgeschichte, in deren Verlauf sich das einstige Sorgenkind zum Kultort für zeitgenössische Musik gewandelt hat.
Für sein Projekt Zeal & Ardor hat der Basler Manuel Gagneux Black Metal mit Black Music kombiniert. Damit erregt er Aufsehen in der ganzen Welt.
Bei Bruckner, aber auch bei Beethoven spürte er «das wunderbar Metaphysische des Universums». Jetzt ist der grosse polnische Dirigent Stanisław Skrowaczewski im Alter von 93 Jahren gestorben.
Von 2013 bis 2015 gehörte die französische Sopranistin Julie Fuchs zum Ensemble des Zürcher Opernhauses. Nun ist die Sängerin für einen faszinierenden Arienabend an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.
Noch immer eine Rarität: Die Philharmonia Zürich liess Alexander Zemlinskys «Seejungfrau» in raffinierten Klängen baden. Zuvor beeindruckte Arabella Steinbacher mit Alban Bergs Violinkonzert.
Denis Johnson hat Sierra Leone als Reporter kennengelernt. Nun schickt er zwei lausige Kerle dorthin: Sie wollen einen Coup landen und sich ein Paradies ganz nach ihrem Geschmack einrichten.
Die österreichische Schriftstellerin Simone Hirth porträtiert in ihrem Debütroman eine Rebellin gegen Konsum und Konvention. Ihre Heldin steigt aus und ins improvisierte Leben ein.
Der amerikanische Schriftsteller Henry James war oft in Venedig. Die Stadt hat vielerlei Spuren in seinem Werk hinterlassen. Nun folgt Hanns-Josef Ortheil diesen Spuren.
Die Schriftstellerin wird für ihre Erzählkunst mit dem Preis, der am 28. Mai verliehen wird, ausgezeichnet.
Die eigentliche Machtbasis des amerikanischen Präsidenten Donald Trump sind seine Kritiker. Das lernt man aus Georg Seesslens Buch über «Populismus als Politik».
Im Theater an der Wien zeigt Peter Konwitschny ein Stück, das Hitler und Goebbels lobten; derweil spielt die Volksoper Zeitgenössisches als Pflichtübung: Die jüngsten Wiener Opernpremieren irritieren gründlich.
Die Schwulenbewegung hat den mittelalterlichen König Edward II. zu einer Ikone gemacht. Dieser Lesart folgen auch der Schweizer Komponist Andrea Lorenzo Scartazzini und sein Librettist Thomas Jonigk.
Der noch keine dreissig Jahre alte Theaterregisseur Ersan Mondtag gilt als «Shooting Star» der Branche. Am Berliner Maxim Gorki Theater lässt er «Ödipus und Antigone» in neunzig Minuten abrollen.
Männermordender Vamp? Unschuldsmädel mit Schmollmund? Mit Barbara Hannigan in der Titelrolle erlebt man Alban Bergs «Lulu» an der Hamburgischen Staatsoper völlig neu – besonders den problematischen Schluss des Stücks.
Er geht, und er tut es so, wie man es von ihm erwarten konnte. Claus Peymann verabschiedet sich nach siebzehneinhalb Jahren vom Berliner Ensemble. Wird Berlin ihn vermissen?
Spaniens Kunstmesse im Aufwind: 200 Galerien nehmen dieses Jahr an der Arco teil, weit über die Hälfte kommen aus dem Ausland. Gastland ist Argentinien, dessen Kunstszene zurzeit besonders lebendig ist.
Solange wir weiterhin den glücklichen Weg beschreiten und auf Messen und Biennalen, an Museumsnächten und Galeriewochenenden tanzen, mag eine fatale Form der Verausgabung abzuwenden sein.
Anders als die Art Austria ist die neue Art Vienna im Leopold-Museum international und schliesst Kunst des 19. Jahrhunderts mit ein. Trotz den oft grosszügigen Messeständen sind die Wände aber allzu eng behängt, gerne mit plakativen Dekorations-Bildern.
Kapstadt hat sich zum Zentrum für afrikanische Gegenwartskunst gemausert. Und in diesem Jahr hat die hauseigene Messe endgültig internationales Niveau erreicht.
Ins Engadin zog es die beiden Quereinsteiger schon früh. Ruedi Tschudi und Elsbeth Bisig von der Galerie Tschudi gehörten zu den ersten Galeristen, die die Bergregion als Kunstdestination entdeckten.
Trump ist nicht der erste Präsident, der die Medien zu seinen Feinden erklärte. Nixon wollte mit einer ähnlichen Strategie beim Volk punkten.
Der Wahlkampf hat auch die sozialen Netzwerke erfasst. Mit Mikromarketing will man die einzelnen Wähler zielgenau ansprechen. Im Endeffekt bedeutet dies den Tod der politischen Öffentlichkeit.
Der TV-Satiriker John Oliver hat nachgelegt: Nachdem er Schulungsvideos für den amerikanischen Präsidenten produziert hat, will er Trump jetzt mit Technomusik überzeugen.
Die SRG solle ihre Produktionen allen Interessierten zur Verfügung stellen, verlangen Politiker und Medienvertreter. Der Vorschlag hat seine Tücken.
Der Jurypräsident von World Press Photo hat sich vom Hauptpreis distanziert - zu Recht.
Die Amerikanerin Lydia Davis ist nicht nur eine herausragende Schriftstellerin, sondern auch eine passionierte Übersetzerin. Diese Arbeit empfindet sie als massgebliche Bereicherung ihres Schreibens.
Die Übertragung von Lyrik ist in sich schon eine eminente Herausforderung. Was tun Übersetzer, wenn zudem kulturelle Distanzen überwunden oder extrem unterschiedliche Register bedient werden müssen?
Mit gutem Grund mokierte man sich über das Kauderwelsch der ersten computergenerierten Übersetzungen. Aber seit neuronale Netze eingesetzt werden, hat die Technologie einen Sprung nach vorn gemacht.
Wie steht es wirklich um die kontrovers beurteilte Akustik in der Hamburger Elbphilharmonie? Die ersten Konzerte des laufenden Eröffnungsfestivals ermöglichen aufschlussreiche Beobachtungen.
Die Hamburger Elbphilharmonie ist eröffnet, und die stolze Hansestadt feiert sich ungeachtet aller Widrigkeiten und Krisen rund um den Bau selbst – zu Recht.
Bei Jörg Widmanns Oratorium «Arche» musste sich die nach der Eröffnung kontrovers beurteilte Akustik der Elbphilharmonie erstmals in einer raumgreifenden Uraufführung bewähren.
Die Elbphilharmonie war in den vergangenen 16 Jahren abwechselnd ein Symbol des Aufbruchs und finsterstes Menetekel. Am Ende aber ist das himmelstürmende Gebäude viel mehr geworden als ein Konzertsaal.
Der weltweit ausstrahlende Erfolg der Hamburger Elbphilharmonie lässt vielerorts Überlegungen zu vergleichbaren kulturellen Leuchtturm-Projekten laut werden. Auch in Zürich könnte man sich dazu durchaus Gedanken machen.
Die Basler Architekten Herzog & de Meuron hörten am Montag, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung, zum ersten Mal das Herz ihrer Elbphilharmonie schlagen. Bericht von einem exklusiven Abend.
Mit dem Umbau und der phänomenalen Aufstockung eines alten Kaispeichers im Hamburger Hafen ist den Basler Architekten Herzog & de Meuron ein Meisterwerk gelungen. Eine Betrachtung.
Hamburg verdankt die Elbphilharmonie zwei Privatleuten – und einer Reihe von Zufällen
Bedeutende Denker, Forscherinnen und Wissenschafter präsentieren zwölf Begriffe, die jeder kennen sollte. Erlaubt ist, was fruchtbare neue Hypothesen hervorbringt.
Wenn wir Realität «sehen», merken wir gar nicht, wie viel wir selbst zu den scheinbar objektiven Eindrücken beisteuern. Beim Blick auf die physische Welt ist das dienlich – beim Urteilen ein Risiko.
Manchmal scheint es, als seien dem Erkenntnisvermögen des Menschen keine Grenzen gesetzt. Aber die Mysterianer mahnen zu Bedacht – und gründen ihre Argumente auf die Evidenz der Evolution.
Ob in der Physik, auf der Strasse oder im Ballett – immer geht es um Körper und ihre Bewegung im Raum. Fast könnte man von einem kleinsten gemeinsamen Nenner des Weltverständnisses reden.
Kein Laie wüsste zu sagen, worum es bei den von Claude-Louis Navier und George Stokes entwickelten Gleichungen geht. Aber die Liste der Bereiche, in denen sie zur Anwendung kommen, ist imposant.
Nie war so viel Information verfügbar wie im Internet-Zeitalter. Aber das heisst nicht unbedingt, dass unser Horizont damit erweitert wird.
Wissen halten wir in der Regel für ein begehrenswertes Gut. Aber es gibt Situationen, in denen Menschen freiwillig auf Information verzichten – und solche, in denen Unwissen sogar zweckdienlich ist.
Der zweite Hauptsatz ist für die Naturwissenschaft, was Shakespeare für die Literatur ist. Und wie Shakespeares Dramen zeigt er, dass Chaos die Natur der Dinge und Ordnung ein hart erkämpftes Gut ist.
Noch streitet die Fachwelt, ob das Weltzeitalter des Anthropozäns eingeläutet werden soll. Aber es bestehen kaum mehr Zweifel, wie entscheidend unsere Spezies die Erde und das Leben darauf verändert.
Den Code zu entschlüsseln, der das Funktionieren unseres Gehirns regiert – das ist einer der ambitioniertesten Träume der Wissenschaft. Der Erkenntnisgewinn wäre formidabel – und nicht ohne Risiken.
Manche Theorien gehen davon aus, dass Wahrnehmung nach dem Prinzip eines «Films im Kopf» funktioniert. Aber es könnte sein, dass unsere Sinne die Umwelteindrücke auf ganz andere Weise erfassen.
Die Idee der effektiven Theorie zeigt schön das Fortschreiten der Wissenschaft. Auch scheinbar fundamentale Einsichten können im Lauf der Zeit vertieft, erweitert und angereichert werden.
Wenn jemand den gesunden Menschenverstand hochhält, so denken wir, dann die Wissenschafter. Aber auch sie lassen sich offenbar immer wieder einmal zu Trugschlüssen verführen.
Landminen und Streumunition gehören zu den verpöntesten Waffen: Sie wirken weit über das Ende eines Konflikts hinaus und die Opfer sind meist Zivilisten. Auch Libanon zählt zu den betroffenen Ländern.
Sand, denken wir, ist das am wenigsten rare aller Güter. Weit gefehlt. Auf den Kapverden bietet das Sammeln des begehrten Baumaterials insbesondere Frauen ein Auskommen – aber es ist strafbar.
Frauen, die sich ihre Rechte nicht erstritten haben, sondern sie traditionsgemäss geniessen – das fasziniert die Fotografin Karolin Klüppel. Beim chinesischen Volk der Mosuo ist sie fündig geworden.
Wem käme es schon in den Sinn, in Affoltern auf Sightseeing-Tour zu gehen? Der NZZ-Fotograf Simon Tanner liess sich auf das Experiment ein - mit überraschendem Resultat.
Zum hundertsten Jahrestag der Russischen Revolution beleuchtet eine Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich die damaligen Beziehungen der beiden Länder.
In der Nacht auf Montag ist es wieder soweit: In Hollywood werden die begehrten Oscars verliehen. In 24 Kategorien kann ein Award geholt werden. Eine Auswahl der Favoriten in den Hauptkategorien.
Die David-Hockney-Schau in der Tate Britain zieht rekordverdächtige Besuchermassen an. Liegt es an lebensfrohen, einladenden und leicht zugänglichen Porträts und Landschaftsbildern des Künstlers?
Mit der Benutzung von Robotern verbinden sich soziale und ethische Fragen. Die maschinellen Helfer können uns mit ihrem Erscheinungsbild aber auch ganz einfach erfreuen, wie eine Ausstellung im Vitra-Design-Museum zeigt.


























